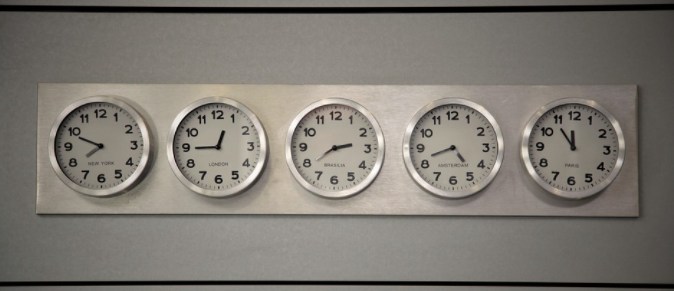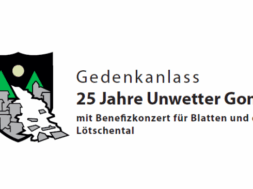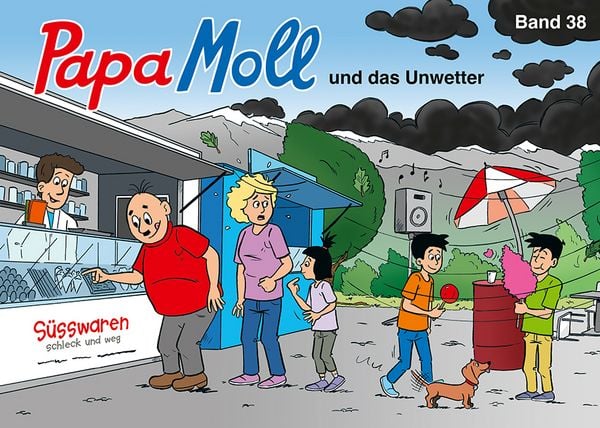Kellerfeuchte in BergregionenUrsachen erkennen und Maßnahmen ergreifen
Wer im Wallis oder anderen Bergregionen ein Haus mit Keller besitzt, kennt oft das Problem: Nicht nur nach der Schneeschmelze im Frühling riecht es modrig, die Wände fühlen sich feucht an, und in der Ecke beim Lichtschacht bilden sich erste grüne Flecken.
Kellerfeuchte ist in Berglagen kein Randphänomen, sondern ein strukturelles Problem, das durch Hangwasser, hohe Niederschläge und spezielle Bodenverhältnisse verstärkt wird. Anders als im Flachland, wo Feuchtigkeit meist punktuell auftritt, kämpfen Bergkeller mit mehreren Faktoren gleichzeitig.
Was folgt, ist keine theoretische Abhandlung, sondern eine praktische Anleitung zum Erkennen und Bekämpfen von Kellerfeuchte – mit konkreten Messverfahren, realistischen Kostenangaben und Lösungen, die tatsächlich funktionieren.
Warum Bergkeller anders sind
Ein Keller in 800 oder 1.200 Metern Höhe verhält sich fundamental anders als einer in Basel oder Zürich auf 300 Metern. Der Hauptgrund: Hangwasser. Wenn im Mai die Schneeschmelze beginnt, fließen jeden Tag hunderte Liter Wasser den Hang hinunter.
Ein Teil versickert, aber bei lehmigen oder felsigen Böden staut sich das Wasser und drückt gegen Kellerwände. Dabei entstehen hydrostatische Drücke von 50 bis 150 Millibar – genug, um durch kleinste Risse in der Abdichtung zu drücken.
Dazu kommt der Temperaturunterschied. Im Sommer kann es draußen 28 Grad haben, während die Kellertemperatur bei konstanten 12 Grad liegt. Warme Luft nimmt mehr Feuchtigkeit auf als kalte – kühlt sie im Keller ab, kondensiert die Feuchtigkeit an den Wänden. Pro Grad Temperaturabfall kann Luft etwa 6 Prozent weniger Feuchtigkeit halten. Bei 16 Grad Unterschied bedeutet das massive Kondensation.
Ein drittes Problem sind alte Bautechniken. Viele Walliser Häuser wurden vor 1950 gebaut, als Kellerisolierung noch Fremdwort war. Die Mauern bestehen oft aus Bruchstein mit Lehmmörtel – ein Material, das Feuchtigkeit wie ein Schwamm aufsaugt. Eine 40 Zentimeter dicke Bruchsteinmauer kann bis zu 80 Liter Wasser pro Kubikmeter speichern. Bei einer 20 Quadratmeter großen Kellerwand sind das schnell 250 bis 300 Liter.
Feuchtigkeitsursachen konkret identifizieren
Bevor irgendwelche Maßnahmen ergriffen werden, muß die Ursache klar sein. Ein Hygrometer mit Datenlogger – kostet etwa 35-60 Franken – wird für mindestens zwei Wochen im Keller platziert. Wichtig: In der Raummitte aufstellen, nicht direkt an der Wand. Die Luftfeuchtigkeit sollte zwischen 50 und 60 Prozent liegen. Werte über 65 Prozent sind kritisch, über 70 Prozent wird es problematisch. Das Gerät zeichnet auch Temperaturschwankungen auf – wenn die Temperatur konstant bleibt, die Feuchtigkeit aber schwankt, deutet das auf eindringendes Wasser hin.
Ein zweiter Test betrifft die Wände selbst. Mit einem Feuchtemeßgerät – die professionellen kosten ab 80 Franken, einfache Modelle gibt es ab 25 Franken – wird an verschiedenen Stellen gemessen. Bei Bruchsteinwänden sind Werte um 15-20 Prozent normal. Über 25 Prozent wird es kritisch, über 35 Prozent ist definitiv zu viel. Wichtig: An mindestens sechs verschiedenen Stellen messen, jeweils in Bodennähe, auf halber Höhe und oben.
Der Folientest zeigt, ob Feuchtigkeit von außen eindringt oder im Raum kondensiert. Eine 50×50 Zentimeter große Plastikfolie wird mit Klebeband luftdicht an die Wand geklebt. Nach 48 Stunden nachschauen: Bildet sich Feuchtigkeit zwischen Folie und Wand, kommt sie von außen. Bildet sich Feuchtigkeit auf der Folie, kondensiert sie aus der Raumluft. Bei Bergkellern ist meist beides der Fall.
Wer feuchte Kellerwände hat und bestimmte Gegenstände wie Winterkleidung, Sportausrüstung oder Dokumente schützen möchte, überlegt sich manchmal, empfindliche Dinge extern zu lagern. Anbieter wie Boxly oder andere Dienste, bei denen man Lagerräume mieten kann, bieten klimatisierte Alternativen – eine pragmatische Übergangslösung, während die eigentliche Kellersanierung geplant wird.
Drückendes Wasser von außen: Die größte Herausforderung
Wenn Wasser von außen gegen die Kellerwand drückt, helfen Innenmaßnahmen nur bedingt. Die Lösung ist eine Drainage entlang der Außenwand. Dafür wird der Bereich neben dem Haus bis zur Fundamentsohle ausgegraben – bei einem typischen Berghaus sind das 1,80 bis 2,20 Meter Tiefe. Pro laufendem Meter Graben muss man mit 180-250 Franken rechnen, wenn man eine Baufirma beauftragt. Bei einem 12 Meter langen Keller sind das schon 2.200 bis 3.000 Franken nur fürs Ausheben.
Die Drainage selbst besteht aus einem gelochten Kunststoffrohr mit 10 oder 12 Zentimeter Durchmesser, eingebettet in Kies. Das Rohr kostet etwa 8-12 Franken pro Meter, der Kies nochmal 40-60 Franken pro Kubikmeter. Für die 12 Meter braucht man etwa 3-4 Kubikmeter Kies, also 120-240 Franken. Das Drainagerohr wird mit Gefälle verlegt – mindestens 1 Prozent, besser 2 Prozent – und entwässert in einen Sickerschacht oder die Kanalisation. Ein Sickerschacht mit 80 Zentimeter Durchmesser und 1,50 Meter Tiefe kostet komplett etwa 350-500 Franken.
Nach dem Einbau der Drainage wird die Kellerwand von außen mit Bitumendickbeschichtung versiegelt. Die Beschichtung wird in zwei Schichten aufgetragen, Gesamtdicke etwa 4-5 Millimeter. Kostet etwa 25-35 Franken pro Quadratmeter Material, plus Arbeitslohn. Für die 12 Meter lange und 2 Meter hohe Wand sind das 24 Quadratmeter, also 600-840 Franken nur Material. Die Arbeit kostet nochmal das Doppelte bis Dreifache.
Gesamtkosten für eine komplette Außenabdichtung mit Drainage: Bei einem mittelgroßen Keller etwa 8.000 bis 12.000 Franken. Klingt viel, löst das Problem aber dauerhaft. Halbherzige Lösungen kosten am Ende mehr, weil sie nach wenigen Jahren wiederholt werden müssen.
Kondensation von innen: Lüften allein reicht nicht
Wenn die Feuchtigkeit hauptsächlich aus der Raumluft kondensiert, hilft eine Kombination aus Lüftung und Entfeuchtung. Das klassische Kellerfenster, das im Sommer den ganzen Tag offen steht, verschlimmert das Problem meist. Warme Außenluft mit 70 Prozent relativer Feuchte bei 25 Grad enthält etwa 15 Gramm Wasser pro Kubikmeter. Kühlt sie im Keller auf 12 Grad ab, steigt die relative Feuchte auf über 95 Prozent – die Wände werden klitschnass.
Richtig lüften bedeutet: Nachts oder früh morgens, wenn es draußen kühler ist als im Keller. Das ist im Sommer nur zwischen 5 und 8 Uhr der Fall. Die Fenster werden dann für 20-30 Minuten komplett geöffnet – Stoßlüftung, kein Dauerkippen. Ein Thermometer innen und außen hilft, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Wenn außen 14 Grad oder kühler sind und innen 12 Grad herrschen, macht Lüften keinen Sinn.
Schimmel: Wenn es zu spät ist
Ab 70 Prozent relativer Luftfeuchte wächst Schimmel – und zwar innerhalb von 48 bis 72 Stunden. Die schwarzen oder grünen Flecken sind nicht nur hässlich, sondern gesundheitsgefährdend. Besonders gefährlich sind Sporen von Aspergillus und Penicillium, die Atemwegsprobleme und Allergien auslösen.
Oberflächlicher Schimmel auf Putz oder gestrichenen Wänden lässt sich mit 70-prozentigem Ethanol entfernen. Das gibt es in der Apotheke für etwa 8-12 Franken pro Liter. Mit einem Schwamm auftragen, 10 Minuten einwirken lassen, dann abwischen. Schutzhandschuhe und FFP2-Maske tragen. Bei Flächen über einem Quadratmeter oder Schimmel, der tiefer ins Material eingedrungen ist, sollte ein Fachmann ran. Die Kosten liegen bei 80-150 Franken pro Quadratmeter für professionelle Schimmelsanierung.
Nach der Entfernung muss die Ursache behoben werden, sonst kommt der Schimmel zurück. Schimmelfarbe oder Anti-Schimmel-Mittel sind Symptombekämpfung, keine Lösung. Sie verzögern das Problem um ein paar Monate, mehr nicht.
Was bei Walliser Immobilien besonders zu beachten ist
Bergregionen haben spezielle Herausforderungen, die in Immobilienfragen im Wallis immer wieder auftauchen. Viele alte Häuser stehen am Hang, teilweise mit dem Keller komplett im Berg. Hier ist eine nachträgliche Außenabdichtung extrem aufwendig oder unmöglich. Die Alternative: Eine Innendichtung mit Dichtschlämme. Das ist eine zementgebundene Masse, die in zwei Schichten aufgetragen wird – Gesamtdicke etwa 8-10 Millimeter. Kostet etwa 15-25 Franken pro Quadratmeter Material, hält aber nur, wenn kein zu großer hydrostatischer Druck von außen herrscht.
Bei starkem Hangwasser bleibt manchmal nur eine weiße Wanne – eine wasserdichte Betonschale, die innen eingebaut wird. Das ist teuer, etwa 200-350 Franken pro Quadratmeter, löst aber selbst extreme Probleme. Der nutzbare Kellerraum wird dabei um 15-20 Zentimeter kleiner, weil die neue Wand vor der alten steht.
Prävention: Günstiger als Sanierung
Wer einen trockenen Keller hat, sollte ihn so halten. Das bedeutet: Regenrinnen und Fallrohre regelmäßig reinigen, damit Wasser nicht an der Hauswand runterläuft. Ein verstopftes Fallrohr kann bei Starkregen 50 Liter pro Minute an der Wand runterlaufen lassen – nach einer Stunde sind das 3.000 Liter direkt neben dem Fundament.
Die Geländeoberfläche rund ums Haus sollte vom Gebäude wegfallen – mindestens 2 Prozent Gefälle auf den ersten 2 Metern. Klingt selbstverständlich, ist aber bei vielen Althäusern nicht gegeben. Besonders nach Umbauten, wenn neue Terrassen oder Zufahrten angelegt wurden, stimmt das Gefälle oft nicht mehr.
Kellerfenster mit Lichtschächten sind Schwachstellen. Die Schächte müssen Abläufe haben, sonst sammelt sich Regenwasser darin. Ein Lichtschacht mit 80×60 Zentimeter Grundfläche fasst bei 40 Zentimeter Füllhöhe etwa 200 Liter Wasser. Das drückt direkt gegen das Fenster und findet jeden undichten Spalt.
Fazit: Keller im Griff behalten
Kellerfeuchte in Bergregionen ist ein komplexes Problem, aber kein unlösbares. Die wichtigste Erkenntnis: Die Ursache muss klar sein, bevor Geld ausgegeben wird. Ein Hygrometer für 50 Franken und zwei Wochen Geduld verhindern teure Fehlentscheidungen. Und wer die Wahl hat zwischen billigen Innenmaßnahmen und einer teuren, aber dauerhaften Außenabdichtung, sollte langfristig denken. Ein trockener Keller erhöht nicht nur die Lebensqualität, sondern auch den Wert der Immobilie – und das lässt sich in Franken ausdrücken.
(pd, rm)