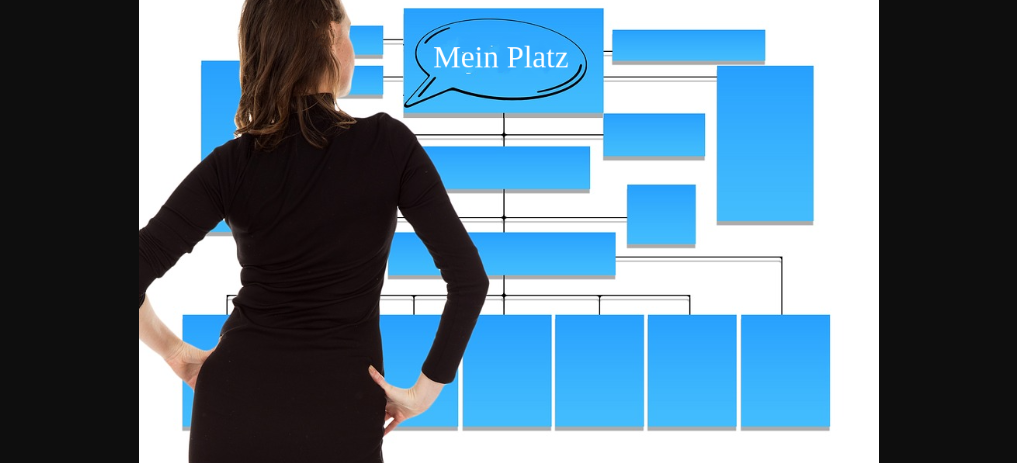
Misstöne im Orchestergraben
Ein Kommentar von Thomas Baumann
Die Viola ist verstimmt. Nicht irgendeine Viola, sondern Viola Amherd. Mit dunkler Stimme tönt sie: Weil es mit der Teilhabe der Frauen in den Vorständen von Sportvereinen und -Verbänden noch immer zu langsam vorwärts geht, sollen denjenigen, die es bis Ende 2024 nicht auf eine Frauenquote von mindestens vierzig Prozent bringen, Bundesgelder gestrichen werden. Autsch, Saite gerissen!
Bekanntlich ist gut gemeint oft das Gegenteil von gut gemacht. Was ist also von dieser Massnahme zu halten?
Klar ist: Für Sportvereine und -Verbände, die nicht bloss in minimalem Umfang Bundesgelder beziehen, lohnt es sich, nach der neuen Partitur zu spielen, sofern diese denn die Beratungen im Orchestergraben des Bundeshauses übersteht.
Aber das Reservoir an geeigneten Frauen ist nicht unerschöpflich – diese wachsen bekanntlich nicht wie Gras auf den Alpweiden. Woher nehmen und nicht stehlen?
Es ist hier eine zweifache Unterscheidung vorzunehmen: Einerseits zwischen Vereinen und Verbänden, die Bundesgelder beziehen und anderen, die keine Bundesgelder beziehen. Andererseits ist zu unterscheiden zwischen bezahlten und unbezahlten Vorstandsmandaten.
Wasserkopf oder Nullsummenspiel
Grosse Vereine und Verbände, die ihre Vorstandsmitglieder bezahlen und Bundesgelder beziehen, haben drei Quellen, woher sie weibliche Vorstandsmitglieder rekrutieren können: (1) sie (be-)fördern Talente aus der eigenen Organisation; (2) sie rekrutieren sie bei kleineren Vereinen und Verbänden derselben Sportart – der nationale Verband wirbst sie also z.B. bei den Kantonalverbänden ab; (3) sie werben Frauen von (grossen) Vereinen und Verbänden aus anderen Branchen ab, die keine Frauenquote kennen.
Nur im ersten Fall stellt sich die gewünschte Frauenförderung tatsächlich ein. Im zweiten Fall verschiebt sich das Problem einfach auf die untere Ebene. Erhält die untere Ebene keine Bundesgelder, dann dürfte dort durch den „Abfluss“ der Frauen auf die höhere Ebene die Frauenquote im entsprechenden Umfang sinken. Ebenso im Fall 3: Die Erhöhung der Frauenquote bei den Sportvereinen und -Verbänden geht auf Kosten der Frauenquote von Vereinen und Verbänden aus dem nicht sportlichen Bereich, die selber keine Frauenquote kennen.
Die nächste Frage ist, was mit den Männern in den Vorständen geschieht. Wenn ein Vorstand bisher eine Frau und neun Männer hat: Werden dann drei Männer entlassen und durch Frauen ersetzt – oder wird der Vorstand einfach aufgestockt? So dass den neun Männern neu sechs Frauen beigestellt werden und sich die Zahl der Vorstandsmitglieder damit von zehn auf fünfzehn Personen erhöht. Die Gefahr, dass durch die Amherd’schon Massnahmen neue Wasserköpfe geschaffen werden, ist durchaus real. Denn einige der bisherigen Männer dürften Fachkenntnisse besitzen, die sich nicht so einfach von heute auf morgen ersetzen lassen.
Je nachdem, was mit den ‚überzähligen‘ Männern passiert, hat dies auch Auswirkungen auf andere Vereine und Verbände. Wird die Zahl der Vorstandsmitglieder konstant gehalten, so kann – um beim obenstehenden Beispiel zu bleiben – der Fall eintreten, dass von Vereinen und Verbänden aus dem nicht sportlichen Bereich drei Vorstandsfrauen abgeworben werden – und die entlassenen Männer dafür als Vorstandsmitglieder in jene Branchen wechseln. Ausser Spesen nichts gewesen: Die Frauenquote im einen Bereich erhöht sich um exakt denselben Faktor, um den sie sich im anderen – nicht ‚regulierten‘ – Bereich verringert. Ja schlimmer noch: Mehr Personen arbeiten jetzt in einem Bereich, in dem sie weniger Fachkenntnisse besitzen.
Das ‚Problem‘ verlagert sich bloss
Besonders schwierig wird die Ausgangslage für Vereine und Verbände, die zwar Bundesgelder erhalten, bei denen die eigenen Vorstandsmitglieder aber ehrenamtlich arbeiten: Deren weibliche Führungskräfte werden selbstverständlich von Organisationen an- und abgeworben, die bezahlen. So dass diese ehrenamtlich geführten Vereine und Verbände nicht nur ihren ursprünglichen Frauenanteil erhöhen, sondern gar noch einen zusätzlichen Abfluss kompensieren müssten. Ein schier unlösbares Problem.
Frauen werden dort eine extrem „rares Gut“ – und bei einem raren Gut steigen bekanntlich die Preise. Frauen müssten damit eine materielle Entschädigung erhalten. Nur: In Organisationen, die bisher ehrenamtlich geführt werden, kann nicht einfach plötzlich einem Teil der Mitarbeitenden eine Entschädigung ausrichtet werden, dem anderen aber nicht. Entweder setzt hier eine Professionalisierung ein, so dass auch Freiwilligenorganisationen neu allen einen Lohn auszahlen oder es ist Feuer im Dach. Aber: Professionalisierung bringt wiederum die Gefahr von Wasserköpfen mit sich. Denn ebenso schwierig, wie es ist, für ein Ehrenamt Personen zu rekrutieren, ebenso gerne reissen sich Menschen ein bezahltes „Pöstli“ unter den Nagel.
Bei den Vereinen und Verbänden ohne Bundesgelder setzt unzweifelhaft ein Abfluss von weiblichen Führungskräften ein. Ganz einfach, weil sie von Organisationen abgeworben werden, die Bundesgelder beziehen.
Dieser Abfluss wird nur dann durch einen Zufluss neuer weiblicher Führungskräfte zumindest partiell kompensiert, wenn Freiwilligkeit nicht primär internistisch motiviert ist, sondern im Hinblick auf die Chance, später einen bezahlten Posten zu ergattern, ausgeübt wird. Eine ziemlich steile These: Wohl die wenigsten Vorstandsmitglieder eines lokalen Fussballklubs aspirieren darauf, eines Tages beim schweizerischen Fussballverband eine Stelle zu besetzen.
Fazit: Die von Viola Amherd beabsichtigte Frauenförderung hat wohl nur zum kleineren Teil zur Folge, dass tatsächlich Frauen aus dem eigenen Nachwuchs, d.h. der zweiten Führungsetage, gefördert werden. Viel öfter dürften Sie einfach von anderen Vereinen und Verbänden abgeworben werden, mit der Konsequenz, dass dort die Frauenquote entsprechend sinkt. Zudem steigt die Gefahr von Wasserköpfen, wenn die bisherigen Männer fachlich nicht so einfach ersetzbar sind: Diesen Männern stellt man dann einfach ein paar Quotenfrauen zur Seite.












