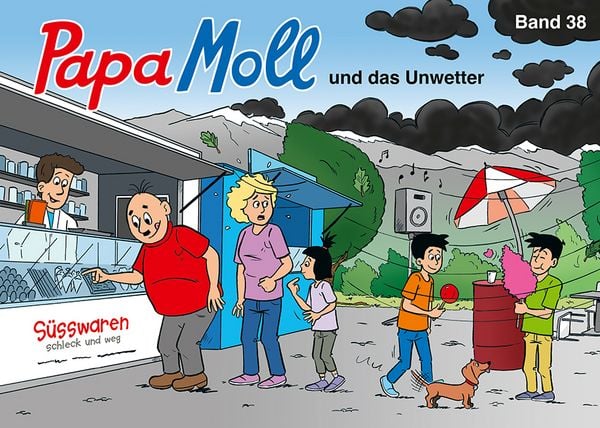Redaktionsrichtlinien Walliser Zeitung
Wahrheit und Klarheit
Wahrheit und Klarheit, so lassen sich die obersten Richtlinien kurz zusammenfassen.
Walliser Zeitung publiziert mit Fokus auf das Wallis das Tagesgeschehen. Unten finden Sie die Redaktionsrichtlinien, weitere Informationen, die noch ausführlicher sind und über die Ausrichtung Auskünfte geben, erhalten Sie darüberhinaus auch hier.
1) Fremdwörter
Unverständliche Fremdwörter werden vermieden oder wenn unvermeidbar, so werden sie zumindest an einer Stelle im Beitag übersetzt.
Wir wollen, daß Leser ohne Zurhilfenahme eines Fremdwörterlexikons die Texte lesen können, das Veröffentlichte gerne gelesen wird und verständlich ist.
Überflüssige Fremdwortschwurbeleien sind daher zu vermeiden. Sie lassen vielleicht den Absender wichtig und gebildet erscheinen, doch oft stellt sich heraus, daß wenn man nachfragt, was denn dieses oder jene Fremdwort genau im Kontext bedeuten soll, daß dann der Autor es selbst nicht einmal sagen kann oder bloß unter ellenlangen Erklärungstexten beschreiben kann was gemeint ist.
Bei Einsendungen mit für das Gros der Leserschaft unveständlichen Fremdwörtern und übermäßigem Fremdwörtergebrauch ersetzen wir diese in verständliche Sprache.
1a) Fremdwörter, die verwendet werden
Sofern Fremdwörter verwendet werden, so werden sie in Anführungszeichen gesetzt. Und zur Verständlichkeit in der Regel in Klammern übersetzt. Bei Gastbeiträgen / Gastautoren wird es so gehandhabt wie der Autor es will. Vgl. auch Punkt 5a).
2) Groß- und Kleinschreibung
Vereinzelt werden Marken, Produkte etc. kleingeschrieben in der Werbung. Oder kommen rein in Großbuchstaben daher.
Wohl um aufzufallen, aus dem Text herauszufallen, also zu Werbezwecken.
In redaktionellen Texten sieht schrecklich aus und zerreißt das Schrift- und Erscheinungsbild. Und zudem liest es sich auch für den Leser schlecht, es verwirrt, wenn am Anfang einer Zeile eine Marke kleingeschrieben daherkommt, man reibt sich die Augen und denkt zuerst intuitiv an einen Tippfehler / Rechtschreibfehler. Gleiches gilt, wenn im Text schrill mit Großbuchstaben eine Marke hervorsticht.
Zugunsten einer guten Lesbarkeit handhaben wir es daher wie andere Redaktionen oder zum Beispiel auch das Lexikon Wikipedia so, daß Markennamen nicht mit reinen Klein- oder Großbuchstaben geschrieben werden, um zu Werbezwecken aus dem Text zu fallen und aufzufallen.
3) Keine Trennstriche in Wörtern
Anders als Text für Print-Produkte sind digitale publizierte Texte dynamisch. Daher werden keine Trennstriche verwandt (Bindestriche hingegen freilich schon).
Digitaler Text ist linksbündig ausgerichtet (Flattersatz). So kann er sich als Fließtext beliebig an die Bildschirmgröße des Endgerätes des Nutzers und an alle Ausgabegeräte (mobile wie auch stationäre) anpassen.
4) Lange Wörter
Anders als in herkömmlichen Printprodukten auf Papier werden digitale Texte auch an mobilen Endgeräten (Smartfons) gelesen. 2012 war bereits das erste Jahr, in welchem gemäß Statistiken mehr Besucher von Webseiten mobile Endgeräte nutzten als stationäre.
Bei langen Wörtern setzen wir zugunsten der Lesbarkeit der Texte auf mobilen Geräten Bindestriche, auch wenn sie gemäß Duden und anderen Wörterbüchern üblicherweise in einem Wort geschrieben werden.
Gerade Beamte, also Leute, die Medienmitteilungen vom Kanton verfassen, schwelgen regelrecht in Schlangenwörtern, die aber an mobilen Endgeräten schlecht lesbar sind.
Beispiel: Gemeindeversammlungs-Beschluß vs. Gemeindeversammlungsbeschluß.
Oder: Hochdruck-Reinigungssystem anstatt Hochdruckreinigungssystem.
5) Sogenannt „geschlechtergerechte“ Sprache
Texte müssen lesbar sein und sich am Leser orientieren. Und nicht verkrampft ideologische Botschaften portieren.
Sogenannt geschlechter-gerechte Sprache irrt zudem in der Annahme, das sprachliche Geschlecht habe etwas mit dem sexuellen Geschlecht zu tun. (der Irrtum läßt sich sogar ganz einfach erkennen, ein Beispiel: In Deutschland etwa sagt man „die“ Mail, in der Schweiz sagt man „das“ Mail. Ist nun eine deutsche Mail sexuell weiblich, eine schweizerische transgender oder hermaphroditisch? Natürlich nicht. Man muß nur in anderen Spachen schauen und erkennt sofort: Wörter, die in der deutschen Sprache maskulinum sind, sind in anderen Sprachen ja femininum oder neutrum. Und umgekehrt. Das sprachliche, das grammatikalische Geschlecht hat also nichts mit dem sexuellen Geschlecht zu tun.)
Zudem – und dies ist der Hauptgrund der gegen sogenannt „geschlechtergerechte“ Schreibweisen spricht – liest kaum ein Mensch gerne schwer verständliche Schlangentexte in denen jedes Geschlecht bis zum Erbrechen immer wieder aufgezählt wird bis hin zu den Polizeihündinnen und Polizeihunden.
Oder Texte, in denen Gendersternchen, Doppelpunkte, Querstriche, Binnen-Großschreibungen, Unterstriche und sonstwas vorkommen.
Texte, die nicht eimal mehr lesbar sind, zumal wenn man den Text vorliest.
Und zu guter letzt lehnen gemäß allen Umfragen sowohl in der Schweiz als auch im deutschsprachigen Ausland die Leser solcherlei Schreibweisen ab, vor allen Dingen auch die jungen Leser.
5 a)
Bei Gastbeiträgen / Gastautoren wird es so gehandhabt wie der Autor es will.
6) Rechtschreibung Gastbeiträge
Während bei Medienmitteilungen, Berichten etc. die Redaktionsrichtlinien Anwendung finden, verhält es sich bei Gastbeiträgen anders.
Hier wird beispielsweise, wenn jemand mit Genderschreibweisen einreicht, dies beibehalten.
7) ß-Schreibung
Nebst der hohen Anzahl an Touristen aus Deutschland und Österreich sowie den Niederlanden an der Leserschaft einer Publikation in einem Tourismuskanton ist zudem auch festzustellen: Der französische Kantonsteil benutzt oftmals ebenfalls ß-Schreibung. Möglicherweise ist dies auch Übersetzungsprogammen geschuldet, weil diese keine gesonderte Sprachversion Schweiz führen. Ebenso wie alle Suchmaschinen. Abgesehen davon, daß es einen hohen Anteil Leser aus DE, AT, LU, LI usw. usf. gibt.
Und abgesehen von historischen Tatsachen, etwa der, daß das ß in der Schweiz nie offiziell abgeschafft wurde und der Grund für die heutige Tastastur die Schreibmaschine ist.
Wenn Sie das Thema tiefergehend interessiert: Lesen Sie hierzu auch eine ausführliche Betrachtung inklusive Historie.
8) Umlaute
Die Poesie ist nicht die Pösi und der Nachname Tuena nicht gleich Tüna.
Umlaute haben also einen Sinn, den der sprachlichen Unterscheidung.
In der Schweiz wurden oftmals Orte (aber auch anderes) mit falschen Großbuchstaben, Ue, Oe, Ae anstatt sprachrichtig Ü,Ö, oder Ä.
Dies kommt noch aus dem Schreibmaschinen-Zeitalter, weil Schreibmaschinen, die auch französische Buchstaben enthielten, keinen Platz mehr für die deutschen Großbuchstaben hatten.
Bekanntermaßen leben wir nicht mehr im Schreibmaschinenzeitalter. Daher werden diese Bezeichnungen sprachrichtig geschrieben, so wie man es auch ausspricht. (Näheres siehe auch hier im letzten Absatz)
9) Lange Wörter
2012 war das erste Jahr, in welchem mehr Leute auf Smartfons Internetseiten aufriefen als auf Geräten mit großen Bildschirmen wie dem stationären oder mobilen Compi.
Lange Wörter sind an Smartfon-Bildschirmen schlecht lesbar bzw. werden falsch abgetrennt oder ragen sogar über den Bildschirmrand hinaus.
Daher schreibt Walliser Zeitung Wörter wie zum Beispiel das Wort „Unterbringungsmöglichkeiten“ nach Möglichkeit mit Bindestrich und in zwei Wörtern: „Unterbringungs-Möglichkeiten“.
10) Zahlen
Zahlen sind leichter zu erfassen, wenn sie als Zahl geschrieben werden. Eine Ausrichtung am Leser ist es daher, auch niedriege Zahlen anders als vom Duden vorgeschrieben eher als Zahl als als Wort zu schreiben.
11) Textblöcke
Der zunehmenden Smartfon-Nutzung ist es auch geschuldet, lange Textblöcke der besseren Lesbarkeit mit mehr Zwischenzeilen bzw. Leerzeilen zu versehen als dies vor dem Smartfon-Zeitalter der Fall war.
Auch hier richtet sich Walliser Zeitung somit am Leser, am Nutzer aus.
12) Kommentare / Leserbriefe
Kommentare werden oft schnell eingetippt, teilweise unterwegs am Smartfon und es passieren leicht Tippfehler.
Die Redaktion behält sich vor, Rechtschreib- oder Tippfehler in Kommentaren zu korrigieren, insbesondere, wenn die Lesbarkeit dadurch erschwert wird.