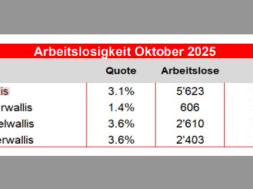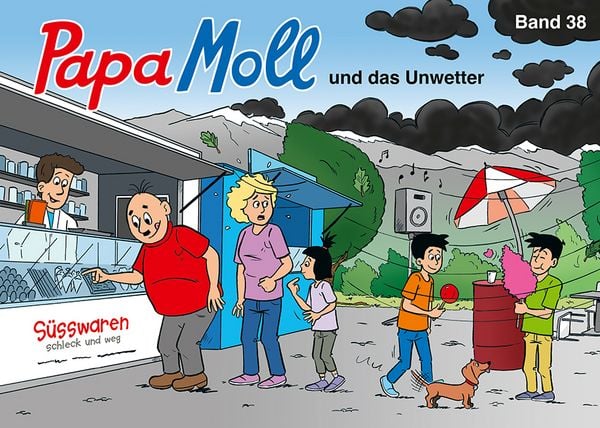Rückblick auf die AHV-Abstimmungen vom Sonntag
Ein Kommentar von Thomas Baumann
Die Niederlage vom letzten Sonntag in der Frage des Frauen-Rentenalters schmerzt die Linke ganz besonders. Und dies nicht nur, weil sie in diesem Fall die Pfründe ihrer Klientel für einmal nicht verteidigen konnte.
Am Tag nach der Abstimmung riefen die SP-Frauen zum „feministischen Streik“ auf.
Mit der Begründung: „Bereits heute erhalten Frauen ein Drittel weniger Rente als Männer.“
Gerne und oft wird von links mit dieser Zahl argumentiert. Was ändert sich mit der sonntäglichen Abstimmung an dieser Zahl? Nichts, rein gar nichts.
Denn sie bezieht sich auf ein einzelnes Rentenjahr. Dass Frauen demnächst erst ein Jahr später Rente beziehen können schlägt sich in dieser Zahl gar nicht nieder. Nicht einmal für Propaganda lässt sich diese Niederlage also nutzen.
Die Frauen erhalten zwar neu weniger Rente – aber der propagandistisch in Feld geführte Rentenunterschied ändert sich um keinen Franken. Genau darum war das tiefere Renteneintrittsalter der Frauen für die Linke derart wichtig: Denn Frauen erhielten dadurch mehr Geld, aber man konnte weiterhin so tun, als erhielten sie viel weniger.
Rentenbezugsdauer kompensiert Rentenhöhe
Der linke Narrativ im Abstimmungskampf ging so: Wenn die Frauen schon ein Drittel weniger Rente erhalten, dann sollen sie wenigstens etwas länger Rente erhalten. Quasi als kleine Kompensation für die erlittene „Ungerechtigkeit“.
Mit ‚Kompensationen‘ zu argumentieren ist ein zweischneidiges Schwert. Tatsächlich öffnet diese Argumentation, wenn man sie konsequent zu Ende denkt, die Büchse der Pandora – aus Sicht der Linken.
Ein tieferes Renteneintrittsalter ist im Grunde nichts anderes als eine spezielle Form von längerer Rentenbezugsdauer: Jedes Jahr früher in Rente bedeutet ein Jahr länger Rente.
Wenn somit ein tieferes Rentenalter aus Sicht der Linken eine Kompensation für eine tiefere Rente ist, dann trifft das – generell – auf eine längere Rentenbezugsdauer zu.
Nicht nur das tiefere Renteneintrittsalter der Frauen kann somit als Kompensation für die tiefere Durchschnittsrente betrachtet werden – sondern auch die längere Rentenbezugsdauer infolge der höheren Lebenserwartung.
Kompensationen haben aber die Eigenschaft an sich, dass sie (1) Unterschiede zuschütten – der eigentliche Zweck von Kompensationen – und dass (2) dadurch verschiedene Grössen gegeneinander aufgerechnet werden (können).
Oder anders gesagt: Wenn ein Drittel (partiell) kompensiert wird, dann ist es eben kein ganzes Drittel mehr. Eigentlich trivial.
Aus einem Drittel wird ein Fünftel
Gehen wir von der Prämisse der SP-Frauen aus, dass die Rente der Frauen nur zwei Drittel der Rente der Männer betrage.
Gleichzeitig haben Frauen im Alter von 65 Jahren eine Restlebenserwartung von 22.2 Jahren, Männer hingegen nur von 19.3 Jahren. Frauen erhalten also schon rein aufgrund ihrer längeren Lebenserwartung fast drei Jahre länger Rente als Männer.
Um wie viel kompensiert dies die tiefere Rentenhöhe?
2/3 x (22.2 Jahre / 19.3 Jahre) = 0.77.
Betrachtet man eine längere Rentenbezugsdauer als Kompensation für eine Rentendifferenz, dann verringert die längere Lebenserwartung der Frauen die Rentendifferenz über den ganzen Lebenszyklus von einem Drittel auf „nur“ noch 23%. Zählt man noch das zusätzliche Rentenbezugsjahr durch das bisherige Renteneintrittsalter 64 für Frauen dazu, sinkt die Differenz weiter auf 20%.
Man mag das für viel oder wenig halten – Fakt ist: 20% sind kein Drittel.
Wäre es der Linken nur um die Differenz der durchschnittlichen Jahresrente zwischen Männern und Frauen gegangen, hätte sie das tiefere Rentenalter der Frauen gar nicht zu kümmern brauchen. Schliesslich ändert es nichts daran.
Betrachtete sie das tiefere Rentenalter der Frauen hingegen als Kompensation für die tiefere Durchschnittsrente, dann wäre diese Kompensation konsequenterweise auch mathematisch zu berücksichtigen gewesen – und das oft zitierte Drittel dann eben kein Drittel mehr.
Tieferes Renteneintrittsalter und längere Lebenserwartung der Frauen hatten für die Linke den angenehmen Effekt, dass der effektive Rentenunterschied zwischen Frauen und Männern über den gesamten Lebenszyklus zwar „nur“ 20 Prozent betrug, man aber stattdessen weiterhin von einer Rentendifferenz von einem Drittel sprechen konnte. Dieser Vorteil ist mit der sonntäglichen Abstimmung wenigstens zum Teil dahin.