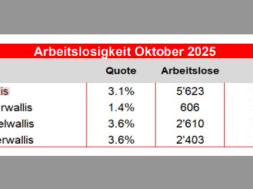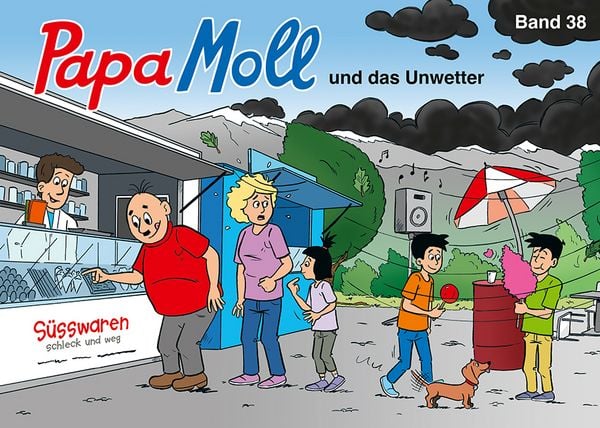Albert Baehny gehtWie verrückt darf ein CEO sein?
Von Klaus Stöhlker
Als sei ihm ein Felsbrocken von der Brust gefallen, stellt sich der noch wenige Stunden amtierende VR-Präsident der Lonza, Albert Baehny, der Öffentlichkeit. Lachend teilt er seinen «stakeholders», den Aktionären, den Mitarbeitern und den Wallisern mit: «Ein guter CEO muss verrückt sein.»
Am kommenden Mittwoch, wenn er, der den Platz des CEO’s der Lonza schon aufgeben musste, nun auch als Präsident des Verwaltungsrates seinen Hut nimmt, werden viele aufatmen.
Die Lonza-Aktie, in der Aera Baehny abgestürzt, hat sich seit Bekanntgabe seines Doppelrücktritts deutlich erholt. Die Aktionäre glauben wieder an die Zukunft der Lonza, denn der sich selbst als verrückt erklärende Albert Baehny will sich nun zurückziehen, wandern und Konzerte besuchen.
Seinen Rücktritt als VRP bei der Geberit Holding will er noch nicht bekannt geben, wie er soeben der «NZZ am Sonntag» mitgeteilt hat, wo Domini Feldges und Guido Schätti ein Interview mit ihm führten, das in die Schweizer Mediengeschichte eingehen dürfte.
Geht es in den Chefetagen der Schweizer Wirtschaft nicht ohne «crazyness», wie Baehny behauptet? Dürfen nur CEO’s «crazy» sein oder auch deren leitende Mitarbeiter, vielleicht sogar auch einfache Mitarbeiter, die es besser wissen, als «die da oben»?
Im Falle des Bio-Konzerns Lonza durfte es nur einer: Albert Baehny. Zwei seiner CEO’s feuerte er nach sehr kurzer Zeit, andere gingen freiwillig, nicht immer die Schlechtesten.
Das Konzernergebnis konnte sich nicht mehr sehen lassen, die Glaubwürdigkeit der Lonza sank mit dem Image ihres Präsidenten.
Wie sieht es nun aus in der Schweizer Wirtschaft mit Baehnys Aufforderung: «Ein guter CEO muss verrückt sein.»
Gehen wir einmal davon aus, dass er damit Unternehmensleitungen im Allgemeinen meinte, wird einiges klarer, was sich in den letzten Jahren in der Schweizer Wirtschaft abspielte. Ich greife einige repräsentative Beispiele heraus.
Bei der Roche war der seinerzeitige Hauptaktionär Thomas Schmidheiny davon überzeugt oder verrückt genug, den Merger mit der französischen Lafarge Gruppe durchzusetzen. Seinen Mitaktionären versprach er einen neuen Börsenkurs der Holcim-Lafarge-Aktie von 100 Franken. So geschah es gegen die Warnungen von Max Amstutz, dem langjährigen CEO von Holcim, der auch in der NZZ und der «Finanz + Wirtschaft» offenlegte, wie «crazy» Thomas Schmidheiny sein musste.
Das Ergebnis kennen wir: Beide Unternehmen trennten sich wieder wegen Unvereinbarkeit. Die Holcim-Aktie erholte sich erst wieder, seit Jan Jenisch dort das Ruder führt.
Zweites Beispiel: Migros
Der unglaublich schwer zu führende Migros-Konzern war verrückt genug, in den letzten Jahren in alle Richtungen zu expandieren. Wie wir heute wissen, ging dies, im Unterschied zur Coop, schief.
Jetzt sucht die Migros wieder den Weg zurück in die unternehmerische Vernunft. Es wird schwer sein und Jahre dauern, denn die Schweizer wie die deutsche Konkurrenz nutzt die Spielräume, die eigene Expansion voranzutreiben.
Drittes Beispiel: Nestlé
Ganz offensichtlich ist CEO Mark Schneider bisher nicht verrückt genug, um mit Nestlé einen grossen Sprung nach vorn zu wagen. Die Nestlé-Konzernleitung ist unter seiner Führung seit zwei Jahren mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Im besten Fall ist zu vermuten, dass der crazy-Sprung vorwärts demnächst erfolgen wird; im schlechtesten Fall steckt Nestlé einfach fest. Das wäre eine weitere Gross-Niederlage à la Swissair und Credit Suisse für einen wichtigen Konzern und die Schweiz.
Viertes Beispiel: Raiffeisen
Pierin Vinzenz als CEO mit seiner frühzeitigen Expansion in den Hypothekarmarkt, als alle anderen nur von einer kommenden Immobilienkrise sprachen, war wegweisend für die Raiffeisen-Gruppe, die heute noch von seinen unternehmerischen Vorlagen gut lebt. Was er weniger unter Kontrolle hatte, war sein Privatleben, das mehr als «crazy» war und seinen Sturz herbeiführte. Offensichtlich stimmte damals bei Raiffeisen die Machtbalance in der Führung so wenig wie später auch bei der Lonza.
Jedem Leser werden noch einige Beispiele mehr einfallen.
Albert Baehny bleibt bei seiner Theorie: «Ohne Craziness gibt es keine Innovation.»
Er beruft sich auf den ehemaligen Roche-Konzernchef Fritz Gerber, als er für über zwei Milliarden US-Dollar die US-Firma Gentech für Roche kaufte. Ich hatte die Gelegenheit, Fritz Gerber während mehrerer Jahre genau beobachten zu können. Er war alles andere als «crazy», sondern ein sehr guter Rechner, der seine Züge wie ein Schachspieler vornahm.
Ein weiterer Zeuge, Daniel Vasella, seinerzeit Chef von Novartis, war vielleicht eher ein schlechter Kommunikator als verrückt in seinen Handlungen. Der Bau des Novartis-Campus in Basel und die Übernahme von einem Drittel der Roche-Aktien waren kühl geplant und beides war enorm erfolgreich. Deshalb habe ich, gratis und aus Überzeugung, das 70 Mio-Salär von Daniel Vasella stets verteidigt. Der Mann war nicht verrückt, sondern sein Geld wert.
Albert Baehny, der heute vom CEO Transparenz und gute Kommunikation verlangt, war in seiner Zeit bei Lonza alles andere als transparent und wenig kommunikativ. Er gehörte zu jenen Unternehmern, welche dies in erster Linie von ihren direkt unterstellten Mitarbeitern verlangen. Selbst beschränkte er sich auf ein Minimum.
Verrückte Unternehmungen hatten wir in Europa zu genüge.
Die Reise Marco Polos nach China.
Die Eroberung Lateinamerikas auf der Suche nach El Dorado.
Die Segelschiff-Kapitäne, die Gewürze aus Asien nach Europa brachten.
Wer genau hinschaut, sieht, dass die sozialen Kosten dieser unternehmerischen Entdeckungen und Eroberungen gigantisch waren. Ein grosses Unternehmen dem crazy Ego eines Menschen auszuliefern, halte ich für fahrlässig. Dann gilt «The winner takes it all» und der Rest kann sehen, wo er bleibt.
Gute Reise, Albert Baehny.
Die Erstpublikation des vorliegenden Beitrags erfolgte auf InsideParadeplatz.ch
Lesen Sie auch:
(Foto: Lonza 2017)