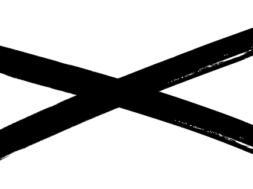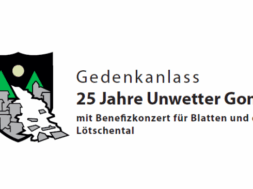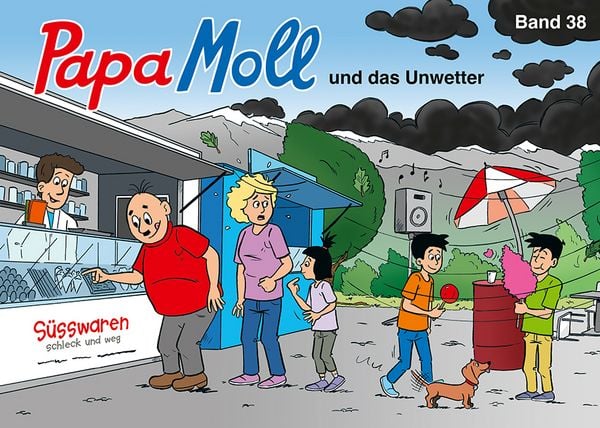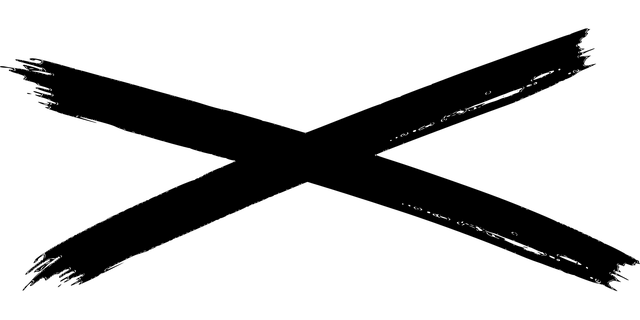
Bundesrat lehnt «Waldschutz-Initiative» und «Gemeindeschutz-Initiative» ab
Der Bundesrat hat am heutigen 22. Oktober 2025 eine Aussprache zu den zwei Volksinitiativen «Gegen die Zerstörung unserer Wälder durch Windturbinen (Waldschutz-Initiative)» und «Für den Schutz der direkten Demokratie bei Windparks (Gemeindeschutz-Initiative)» geführt, wie er schreibt.
Er lehne beide Initiativen ab. Dies sogar ohne einen Gegenvorschlag, sprich, er möchte gar nicht auf die Anliegen der zustandegekommenen Volksinitiativen eingehen.
Die Kernanliegen der beiden Volksinitiativen zum Schutz der Wälder und der Gemeinden würden in der geltenden Gesetzgebung bereits berücksichtigt und mit dem vom Parlament im Herbst 2025 verabschiedeten Beschleunigungserlaß gestärkt, äußert er.
Das UVEK werde dem Bundesrat die Botschaften zu den beiden Initiativen im Mai 2026 vorlegen, teilt dieser mit, dennoch lehnt er sich bereits jetzt ab.
Im Einzelnen äußert sich der Bundesrat wiefolgt (kursiv):
Am 25. September 2025 sind die beiden Eidgenössischen Volksinitiativen zustande gekommen. Die Waldschutz-Initiative will in der Bundesverfassung festhalten, dass im Wald und im Abstand von 150 Metern zu Wald und Waldweiden keine Windkraftanlagen gebaut werden dürfen. Solche Anlagen müssten zudem abgebrochen werden, wenn sie nach dem 1. Mai 2024 erstellt wurden. Die Gemeindeschutz-Initiative will in der Bundesverfassung verankern, dass jedes Windkraftprojekt die Zustimmung der Standort- und der besonders betroffenen Nachbargemeinden braucht. Anlagen, die nach dem 1. Mai 2024 erstellt wurden, bedürfen der nachträglichen Zustimmung durch die Stimmberechtigten.
Initiativen schwächen die Versorgungssicherheit
Die inländische Stromproduktion muss ausgebaut werden, denn der Stromverbrauch wird in den nächsten Jahren durch die Dekarbonisierung zugunsten des Netto-Null-Ziels bis 2050, die zunehmende Digitalisierung und das Bevölkerungswachstum stark ansteigen. Das Energiegesetz enthält die Ziele zum Ausbau der erneuerbaren inländischen Stromproduktion. Die Versorgungssicherheit im Winter soll gemäss Stromversorgungsgesetz durch Speicherwasserkraftwerke sowie Solar- und Windkraftanlagen von nationalem Interesse gestärkt werden. Diese Bestimmungen hat die Stimmbevölkerung 2024 in der Abstimmung zum Stromgesetz bestätigt. Eine Annahme der Initiativen würde den Ausbau der Windenergie in der Schweiz stark einschränken. Da die Windenergie zwei Drittel ihres Stroms im Winterhalbjahr produziert, würde damit ein Pfeiler der Versorgungssicherheit im Winter wegbrechen und müsste mit anderen Produktionstechnologien oder Importen kompensiert werden.
Gemeindeschutz-Initiative
In den allermeisten Kantonen benötigen Windenergieprojekte heute eine kommunale Nutzungsplanung und damit auch die Zustimmung der Standortgemeinde. Ausnahmen sind die Kantone Luzern, St. Gallen, Schaffhausen, Neuenburg und Jura, wo die Planungs- und Bewilligungsverfahren für Windenergieprojekte kantonal geregelt sind. Im Kanton Zürich wird eine entsprechende Änderung des kantonalen Energiegesetzes diskutiert. Auf eidgenössischer Ebene sieht der vom Parlament im September 2025 verabschiedete Beschleunigungserlass ein konzentriertes Plangenehmigungsverfahren für den Bau von Solar- und Windenergieanlagen von nationalem Interesse vor. Dabei müssen die Standortgemeinden explizit zustimmen, wenn das kantonale Recht nichts anderes vorsieht. Die Stellung der Gemeinden wird deshalb durch den Beschleunigungserlass gestärkt und das Kernanliegen der Gemeindeschutz-Initiative erfüllt. Ein Veto-Recht der Standortgemeinde und betroffenen Gemeinden in der Verfassung wäre ein weitgehender Eingriff in die verfassungsmässige Kompetenz der Kantone zur Regelung von Bau- und Planungsfragen sowie in die entsprechende Gesetzgebung der Kantone.
Waldschutz-Initiative
Windenergieanlagen von nationalem Interesse gelten laut Waldgesetz (Abstimmung von 2024) grundsätzlich als standortgebunden und dürfen mit einer Rodungsbewilligung im Wald gebaut werden. Die bundesrechtlichen Vorschriften im Waldgesetz, im Natur- und Heimatschutzgesetz und im Umweltschutzgesetz müssen dabei aber vollumfänglich eingehalten werden. Die Kantone legen gemäss Energiegesetz in ihren Richtplänen für die Nutzung der Windkraft geeignete Gebiete fest und müssen dabei die verschiedenen Schutzinteressen (Landschaft, Biotope, Walderhaltung, Landwirtschaft, etc.) berücksichtigen. Für Windenergieanlagen ab 30 Metern Gesamthöhe müssen die Kantone mit einer Umweltverträglichkeitsprüfung immer eine umfassende Interessenabwägung durchführen und den Schutz von möglicherweise betroffenen Waldpartien frühzeitig berücksichtigen. Die Schutzinteressen des Waldes sind damit in der aktuellen Gesetzgebung bereits angemessen berücksichtigt.
Ein Grossteil der von den Kantonen in den letzten Jahren ausgeschiedenen Windenergiegebiete befindet sich zumindest in Waldnähe. Von der Waldschutz-Initiative betroffen wären mindestens 100 Projekte mit je drei bis neun Anlagen und fünf Projekte mit je 12 bis 19 Anlagen. Die von der Initiative geforderten Abstände von 150 Metern betreffen fast die Hälfte der Landesfläche der Schweiz. Dies würde den Spielraum für die Kantone, geeignete Standorte für Windenergieanlagen festzulegen, drastisch einschränken. Die Abstandsklausel von 150 Metern käme damit einem Technologieverbot nahe und verletzt auch die verfassungsmässige Vorgabe nach einer breit gefächerten Energieversorgung. 75 Prozent aller bereits weit fortgeschrittenen Projekte wären schätzungsweise davon betroffen. Mehrere Projekte, die bereits über eine von der Gemeinde ratifizierte Nutzungsplanung verfügen, würden womöglich gar nicht gebaut oder müssten zurückgebaut werden.
Rasche Volksabstimmung über die Initiativen, um Rechtssicherheit zu schaffen
Die Annahme der Initiativen hätte schwerwiegende Auswirkungen auf den Ausbau der Windenergie in der Schweiz. Die Windenergie, die besonders im Winter Strom produziert, könnte damit keinen angemessenen Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten. Die Übergangsbestimmungen (Rückbau für nach dem 1. Mai 2024 erstellte Anlagen) schaffen grosse Rechtsunsicherheit. Der Bundesrat will deshalb rasch Klarheit über den Ausgang dieser Initiativen erhalten und sie so schnell wie möglich dem Parlament überweisen. Das UVEK wird dem Bundesrat bis Mai 2026 die Botschaften zu den beiden Initiativen vorlegen.
(pd, rm)