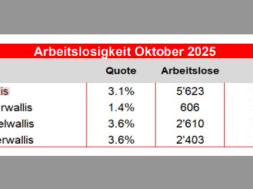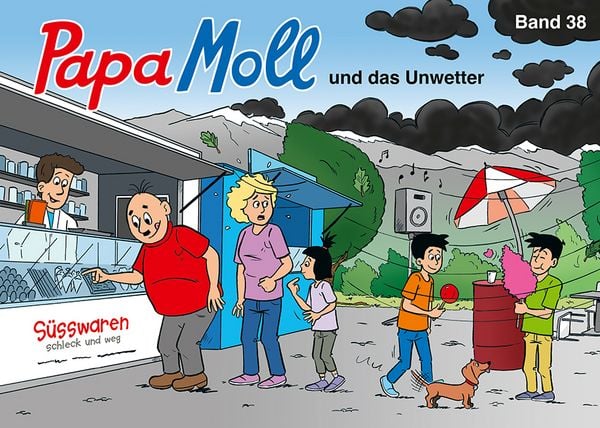Bundesrat will Steuerung der Kaderlöhne seiner Aktiengesellschaften verbessern und vereinfachen
Jüngst gab der Fall Hauser-Süeß wegen Lohnexzessen beim Bundesratspersonal zu reden. Unter Umgehung der Personalverordnung des Bundes bzw. des Porsonalreglements wurde sie als Scheinselbstständige beschäftigt und der Steuerzahler mußte für die Scheinselbstständige Frau mit nur einem Auftraggeber (Viola Amherd) sogar die Sozialversicherungsabgaben übernehmen, obwohl Selbstständige diese normalerweise – wenn sie wirklich selbstständig und nicht scheinselbstständig sind – selber zahlen müssen.
Doch auch in bundesnahmen Unternehmen wie der Swisscom, den SBB.Post und vielen anderen Staatsfirmen oder Quasi-Staatsfirmen werden fürstliche Vergütungen bezahlt.
Und dies kritisieren seit Jahren sowohl die SP als auch die SVP.
So unterstützt die SVP die SP bei ihrer Forderung, daß Bundeskader „nur“ noch 1 Million Franken verdienen dürfen. Viele, wie der Swisscom-Chef müßten also Einschränkungen hinnehmen, bei dem Genannten würde sich der Lohn halbieren.
Kommt nun Bewegung in die Materie?
An seiner Sitzung vom 15. Januar 2025 hat der Bundesrat beschlossen, das Verfahren zum Festlegen der Obergrenzen für die Kaderlöhne bei den bundesnahen Unternehmen anzupassen.
Festsetzung und Kontrolle von Lohnobergrenzen bei den Aktiengesellschaften des Bundes sollen effizienter und zeitgemässer werden. Der Bundesrat hat das Eidgenössische Finanzdepartement beauftragt, ihm entsprechende Vorschläge zu unterbreiten. Zudem räumt er den Unternehmen vorübergehend eine begrenzte Reserve für die Vergütungen 2026 und 2027 ein, deren Verwendung jedoch an Bedingungen geknüpft ist. Schließlich verlangt er mehr Transparenz in den Vergütungsberichten.
Die Generalversammlungen der vom Bund beherrschten Aktiengesellschaften legen jährlich die Obergrenzen der Kadervergütungen für das darauffolgende Jahr fest.
Dies betrifft die SBB, die Schweizerische Post, Skyguide, RUAG MRO, RUAG International, Identitas, SIFEM und Swisscom.
Der Bund steuert damit die Vergütungen der betroffenen Kader durch die Festlegung von Lohnobergrenzen für den Verwaltungsrat und – außer bei der Swisscom – separat für das Verwaltungsratspräsidium sowie für die gesamte Konzernleitung.
Dieser Prozeß hat sich seit 2018 zwar etabliert, weist allerdings Verbesserungspotential auf. Er ist unnötig kompliziert für die Unternehmen und die Bundesverwaltung und verlangt von den Unternehmen teilweise sehr detaillierte Angaben, die schwer zu schätzen sind (z.B. Sozialversicherungsbeiträge, berufliche Vorsorge).
Vertiefte Überprüfung bis Herbst 2026
Als Grundlage für eine Verbesserung dieses Prozesses hat die Eidgenössische Finanzverwaltung deshalb in einem Gutachten die „Best Practices“ im „Say on Pay“-Bereich analysieren lassen.
(Anm. d. Red.: so schwurbelig in Denglisch verlautet es in der Medienmitteilung von heute weiter. „Say on Pay“ heißt zu Deutsch nichts anderes, als Mitspracherechte der Aktionäre bei der Geschäftsführer- und Verwaltungsratsvergütung. Aber warum einfach und verständlich, wenn es auch schwurbelig geht).
13 Empfehlungen
Das oben genannte Gutachten enthält 13 Empfehlungen.
Der Bundesrat hat auf dieser Basis an seiner Sitzung vom 15. Januar 2025 das Finanzdepartement beauftragt, zu prüfen, ob und wie die Massnahmen umgesetzt werden könnten.
Damit solle der «Say on Pay»-Prozeß für die Verwaltung und die Unternehmen verbessert und vereinfacht werden. Eine erste Diskussion darüber will der Bundesrat im Herbst 2026 führen.
Als Übergangsmassnahme bis zur Umsetzung dieser Reformen hat der Bundesrat zudem entschieden, bei den Vergütungsobergrenzen für die Jahre 2026 und 2027 werden die Obergrenzen um eine Reserve von drei Prozent erhöht.
Damit erhalten Post, SBB, Skyguide, RUAG MRO, RUAG International, Identitas und SIFEM einen begrenzten Handlungsspielraum, um unvorhersehbare Schwankungen in den Vergütungen abfedern zu können, die z.B. auf Anpassungen der Familienzulagen oder der Sozialversicherungsbeiträge zurückzuführen sind.
Die Reserve darf grundsätzlich nicht für Lohnerhöhungen oder für den Ausgleich der Teuerung verwendet werden. Hierzu bedürfte es einer expliziten Genehmigung der Eignerstellen.
Außerdem verlangt der Bundesrat von den Unternehmen mehr Transparenz in ihren Vergütungsberichten. Der Expertenbericht hatte diese in der Mehrheit der betroffenen Unternehmen als suboptimal beurteilt. Die Verbesserungen sollen in den Vergütungsberichten 2025 (veröffentlicht 2026) umgesetzt werden.
(pd)