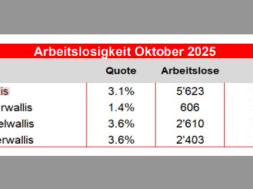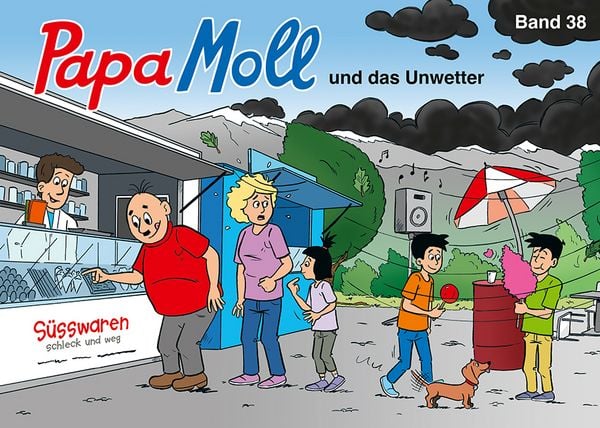Schwerpunkt Mai-Session des Grossen Rats
Ein Gastbeitrag von Emilie Teixeira
Während der Sommer 2021 im Wallis doch ziemlich nass ausfiel, litten mehrere Länder Südeuropas unter einer Hitzewelle mit dramatischen Folgen. Riesige Brände haben tausende von Hektar Wald zerstört, Evakuierungen bedingt und mehrere Todesopfer gefordert.
Auch in Nordeuropa waren die Temperaturen ungewöhnlich hoch und erreichten Rekordwerte.
Auf der anderen Seite des Atlantiks wurde Kanada von einer extremen Hitzewelle heimgesucht: In British Columbia kletterten die Temperaturen auf 49,5 Grad Celsius und lagen damit um ganze 5 Grad über dem historischen Rekord. Die Zahl der plötzlichen Todesfälle war dreimal höher als üblich und die Notfalldienste stiessen an ihre Grenzen.
Die Regierung wurde für ihren Umgang mit der Hitzewelle und die unzureichenden Mittel, die zum Schutz der Bevölkerung bereitgestellt wurden, heftig kritisiert.
Ist das Wallis auf extreme Hitzewellen vorbereitet, wie sie logischerweise in den nächsten Jahrzehnten zu erwarten sind?
Integriertes Risikomanagement
Inzwischen spricht man von „integriertem Risikomanagement“. Ein integriertes Risikomanagement verlangt, dass gegenüber allen Naturgefahren ein vergleichbares Sicherheitsniveau angestrebt wird.
Natürlich kann man bei einer Hitzewelle keine Schutzbauten wie bei einer Lawine errichten oder eine Gefahrenkarte wie bei einer Überschwemmung erstellen. Aber bei der Vorbereitung der Massnahmen, die bei einer Hitzewelle ergriffen werden müssen, gibt es zweifellos viel zu tun.
Im Moment konzentriert sich das Wallis gemäss den Informationen, die ich gefunden habe, auf die Prävention. Es gibt einen „Hitzewellenplan“, der übrigens im Jahr 2021 aktualisiert wurde.
Dieser Plan sieht eine Überwachung der Situation in Zusammenarbeit mit MeteoSchweiz und ein Alarmsystem vor. Zu den Massnahmen, die im Falle einer schweren Hitzewelle (Stufe 4, möglicher Anstieg der Zahl der hitzebedingten Todesfälle) ergriffen werden, gehören beispielsweise die Herausgabe einer Pressemitteilung sowie die Information der Bevölkerung und der Angehörigen der Gesundheitsberufe, wachsam zu sein.
Die Prävention scheint bislang zu funktionieren.
Aber wird unser Gesundheitssystem die Folgen einer grossflächigen Hitzewelle für die Bevölkerung verkraften können?
Wir müssen auch mit Dürre rechnen: Die Wälder werden überwacht und wir werden jeden Sommer mehrmals gewarnt, ja sogar das Entfachen von Feuern wird verboten.
Reichen die Mittel und Partnerschaften aus, wenn es zu gleichzeitigen und großflächigen Bränden kommt?
Welche Auswirkungen hat die Dürre auf die Landwirtschaft, sowohl auf die Viehzucht als auch auf den Ackerbau? Wie kann der zu erwartende Wassermangel behoben werden? Was wird vorrangig behandelt? Welche wirtschaftliche Unterstützung erhalten die am stärksten Betroffenen?
Werden die menschlichen, logistischen und finanziellen Mittel ausreichen, um an „allen Fronten“ gleichzeitig zu agieren?
Vielfältige Folgen
Zugegeben, ich denke weit voraus. Aber die Pandemie, die wir in letzter Zeit erlebt haben, hat uns gezeigt, dass die Folgen einer Krise vielfältig sein und zahlreiche Kollateraleffekte haben können.
Man muss weit denken, und wir wissen inzwischen, dass die Realität unsere Vorstellungskraft übersteigen kann.
Das Phänomen der Hitzekuppel, das für die kanadische Hitzewelle verantwortlich ist, könnte nach Ansicht von Experten durchaus auch in Europa auftreten.
Die Weltorganisation für Meteorologie warnt: „Hitzewellen werden immer häufiger und intensiver (…). Sie beginnen früher und enden später und belasten die menschliche Gesundheit und die Gesundheitssysteme mit immer höheren Kosten“.
Wir wissen es.
Aber sind wir auch bereit? Das ist die Frage, die ich dem Staatsrat in einer Interpellation mit dem Namen „Ist das Wallis gegen eine extreme Hitzewelle gewappnet ?“ gestellt habe.
Emilie Teixeira-Perren ist Grossrats-Suppleantin des PS/GC. Sie hat zu diesem Thema die Interpellation 2021.09.282 eingereicht, die am 12. Mai im Grossen Rat behandelt wird.
Die Interpellation im Wortlaut finden Sie hier: https://parlement.vs.ch/app/de/search/document/171253
Die Antwort des Staatsrats finden Sie hier: https://parlement.vs.ch/app/de/search/document/177109
Si l’été valaisan 2021 a été très humide, plusieurs pays d’Europe du Sud ont connu une météo caniculaire aux conséquences dramatiques. Des incendies d’une ampleur sans précédent ont détruit des milliers d’hectares de forêts, nécessitant des évacuations et causant plusieurs décès.
En Europe du Nord , les températures ont été anormalement élevées, atteignant des records.
De l’autre côté de l’Atlantique , le Canada, a été frappé par une canicule extrême : en Colombie britannique, le mercure a atteint 49,5 degrés celsius, 5 degrés au-dessus du record historique. Les morts subites ont été trois fois plus élevées qu’habituellement et les services d’urgence mis à rude épreuve. Le gouvernement a été vivement critiqué pour sa gestion de la canicule et les moyens insuffisants mis en place pour protéger la population.
Le Valais est-il prêt à faire face à des vagues de chaleur extrêmes, telles que l’on peut logiquement attendre ces prochaines décennies ?
On parle désormais de « gestion intégrée des risques ». Une gestion des risques intégrée exige qu’un niveau de sécurité comparable soit recherché face à tous les dangers naturels.
Bien sûr, on ne peut pas construire d’ouvrage de protection pour une canicule, comme on le ferait pour une avalanche, ni établir une carte de danger comme pour une inondation. Mais il y a sans doute beaucoup à faire dans la préparation des mesures à prendre lors de la canicule.
Pour le moment, selon les informations que j’ai trouvées, le Valais se concentre sur la prévention. Il existe un « plan canicule », d’ailleurs mis à jour en 2021. Ce plan prévoit une surveillance de la situation, en collaboration avec MétéoSuisse et un système d’alarme. Les mesures prises, dans le cas d’une canicule sévère (niveau 4, augmentation possible du nombre de décès dûs à la chaleur), sont par exemple la diffusion d’un communiqué de presse, l’information à la population et aux professionnels de la santé d’être vigilants.
La prévention semble avoir fonctionné jusqu’à présent.
Mais notre système de santé supportera-t-il les conséquences sur la population d’une canicule de grande ampleur ?
Il faut également compter avec la sécheresse : les forêts sont surveillées et on nous met en garde plusieurs fois chaque été, voir on interdit les feux. Les moyens et partenariats sont-ils suffisants en cas d’incendies simultanés et d’envergure ?
Toujours en matière de sécheresse, quels impacts sur l’agriculture, que ce soit l’élevage ou les cultures ?Comment palier au manque d’eau à prévoir ? Qu’est-ce qui sera priorisé ? Quels aides économiques pour les plus touchés ?
Les moyens humains, logistiques, financiers, seront-ils suffisants pour agir sur « tous les fronts » en même temps ?
Certes je vois loin. Mais la pandémie que nous avons connue dernièrement nous a montré que les conséquences d’une crise pouvaient être multiples et avoir de nombreux effets collatéraux. Il faut réfléchir loin et nous savons désormais que la réalité peut dépasser notre imagination.
Le phénomène de dôme de chaleur, responsable de la canicule canadienne, pourrait tout à fait se produire en Europe selon les experts.
L’organisation météorologique mondiale avertit « Les vagues de chaleur sont de plus en plus fréquentes et intenses (…). Elles commencent plus tôt et se terminent plus tard et prélèvent un coût croissant sur la santé humaine et les systèmes de santé. ».
Nous savons.
Mais est-ce que nous sommes prêts ? Voilà la question que j’ai posée au Conseil d’Etat dans une interpellation nommée « Le Valais est-il prêt pour une canicule extrême ? ».
Emilie Teixeira-Perren est suppléante au Grand Conseil du PS/GC. Elle a déposé à ce sujet l’interpellation 2021.09.282, qui sera traitée le 12 mai au Grand Conseil.
L’interpellation : https://parlement.vs.ch/app/fr/search/document/171253
La réponse du Conseil d’Etat : https://parlement.vs.ch/app/fr/search/document/177109
- Zuwenig Regen: Waldbrandgefahr im Wallis
Aufruf zur Vorsicht
- Juli 26, 2024 - Gemeinderats-Wahlen Leuk: SVP Leuk mit breit abgestützter 5er-Liste
Patrick Kuonen, Thierry Zwahlen, Bernardo Amacker, Nevio Imhasly und Sascha Gsponer stellen sich zur Wahl
- Juli 26, 2024 - Zurück vor heimischem Publikum
Der FC Sion empfängt Lausanne-Sport
- Juli 26, 2024