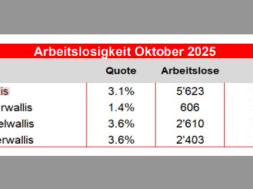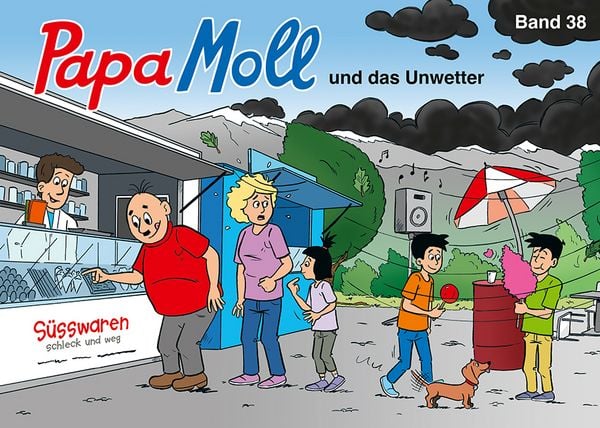Der Höllensturz der Kirche
Von Klaus Stöhlker
Wenn 1000 Jahre vor Gott wie ein Tag sind, wie es im Alten Testament steht, haben die christlichen Kirchen bis vor zehn Minuten einen gewaltigen Aufstieg erlebt, um dann in Europa einen Höllensturz zu erleben, wie ihn keine grosse Religion bisher verzeichnet hat.
Wer Europa und die Menschheit liebt, schaut mit Sorge auf diese Kirche. In der Schweiz werden bald weniger als die Hälfte aller Einwohner Christen sein. In Europa ist nur noch fromm, wer arm und alt ist oder sich von einem Messianismus getragen fühlt, der 2000 Jahre unbeschadet überstanden hat.
Wer diese Zeilen gelesen hat, ist bereits eine Ausnahme-Persönlichkeit.
In ihm ist das Römische Reich noch lebendig, wo die Christen das Individuum erfunden haben, wo die Freiheit des Gewissens und die Grundrechte des Individuums ihren ersten Glanz in Europa erlebten.
In ihm ist die europäische Aufklärung lebendig, die bis heute um ihre Existenz kämpft.
Die katholische Kirche verpasste die Aufklärung. Die bischöfliche Oberschicht verbündete sich mit dem Adel und der französischen Krone, die bald unter der Guillotine endete. Die Kirche war hinter das zurückgefallen, was sie einst angestossen hatte.
Dieses Wissen entnehmen wir dem Buch eines Schweizer Theologen, der nach den Spielregeln der Gegenwart zu den Hervorragendsten seiner Zeit zählt.
Martin Grichting, zuletzt Generalvikar des Bistums Chur, seit einiger Zeit in einer Art Vorruhestand, hat zu Ostern die Schrift «Religion des Bürgers statt Zivilreligion» im Schwabe-Verlag, Basel, vorgelegt. Wer es sich zutraut, diese 87 Seiten zu lesen, wird ein Erweckungserlebnis haben, ganz nach dem Motto des Verlags nach Jeremia 23,29: «Ist mein Wort nicht wie Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert?»
Grichting, Angehöriger eines alten und sehr angesehenen Oberwalliser Geschlechts, aber in Zürich geboren und von da aus in die Welt aufgebrochen, widerspricht der Auffassung, dass Religion und Aufklärung unvereinbar sind. Sein Kronzeuge ist Alexis de Tocqueville, der stets betonte, die Religionen – vor allem die christliche – seien für den Bestand freier und offener Gesellschaften notwendig.
Sind Sie noch dabei, lieber Leser, liebe Leserin?
Die römisch-katholische Kirche hat gemäss Grichting mit dem II. Vatikanischen Konzil (1962-65) Toquevilles Ansatz weitergeführt. Sie ist im Begriff, ein universalisierbares Modell umzusetzen, das es auch anderen Religionsgemeinschaften ermöglicht, sich in andere offene und freie Gesellschaften konstruktiv einzubringen.
Um eines gleich vorweg zu nehmen: Grichting beschäftigt sich nicht mit dem Versagen der christlichen Kirchen, die ihren Gläubigen und deren Kindern Unsägliches angetan haben. Er macht Vorschläge, wie der christliche Glaube für Europa, wo er konstitutionell ist, und für die Welt gerettet werden kann.
Ostern, das wissen viele junge Menschen nicht mehr, ist die Erinnerung an die Zeit der Auferstehung von Jesus Christus. Eine solche Auferstehung braucht auch die katholische Kirche.
Grichting plädiert für die Trennung von Kirche und Staat, wie dies derzeit im Kanton Bern und im Fürstentum Liechtenstein zur Diskussion gebracht wird.
Die Religion müsse unverkürzt Religion bleiben; aus der Schweiz werde deshalb kein Gottesstaat. Die Rechte der christlichen Kirchen müssten auch den 450 000 Mitgliedern des Islam in der Schweiz zugestanden werden.
Die von Martin Grichting als unvermeidlich notwendig bezeichnete Trennung von Kirche und Staat komme nur deshalb nicht zustande, weil die Kirchenorganisation sich dagegen zur Wehr setze. Es liege nun an ihr, die Synthese von Religion und Aufklärung, die sie mit dem II. Vatikanischen Konzil in der Theorie geleistet hat, in die Praxis umzusetzen.
Wegleitend können die Schriften von de Tocqueville sein, weil sie zur Einsicht führen, weil das Bewusstsein von der Abhängigkeit vom Göttlichen es ist, das politische Freiheit ermöglicht, indem es die Tyrannei der Mehrheit zügelt.
Der Mensch bedarf der Weisheit, die im Bewusstsein der Begrenztheit der menschlichen Autonomie wurzelt.
Welches bessere Wort lässt sich den Menschen mitgeben angesichts ihrer Unfähigkeit, den Krieg in der Ukraine und die Hungersnot der Palästinenser zu beenden?
Martin Grichting zeigt einen Weg zu mehr Autonomie des einzelnen Menschen, des Staates und der christlichen Kirche. Den Mut, diesen Weg zu gehen, wünsche ich an Ostern allen, denen unsere über 2000jährige westliche Gesellschaft am Herzen liegt.