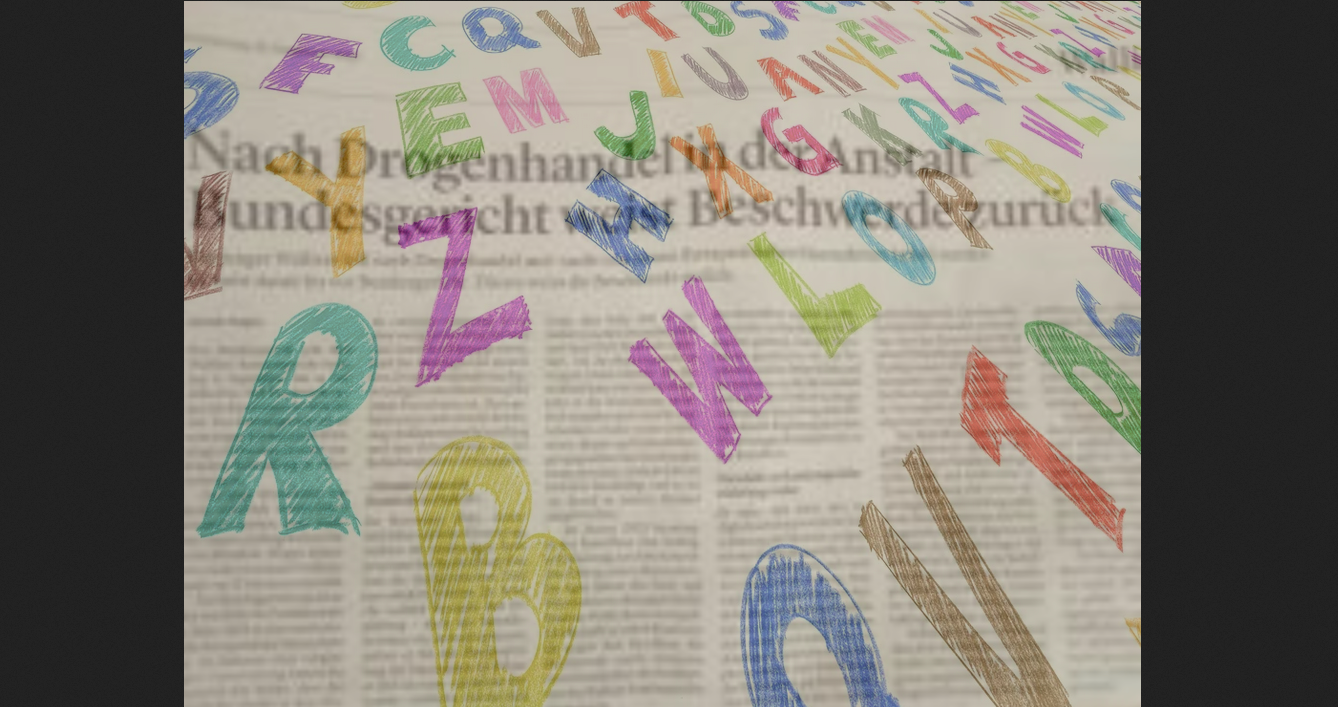
Deutsche Sprache, schwere Sprache
Eine Kolumne von Thomas Baumann
Regelmässig erfreut uns der «Walliser Bote» mit seiner eigenen Interpretation der deutschen Sprache. Und damit auch ja niemand diese sprachliche Kreativität aus Visp verpasst, wird der «Walliser Bote» dankenswerterweise einmal pro Woche als Grossauflage an alle Haushalte im Oberwallis verteilt.
Nicht nur in Kriegen, sondern auch im Pressewesen werden mehr und mehr Kindersoldaten an die Front geschickt. Billiges Kanonenfutter eben. Auch der «Walliser Bote» macht da keine Ausnahme.
Frisch ab Kollegium Spiritus Sanctus echauffiert sich die Jungmannschaft schon einmal über Gewalt gegen Politiker — und vermischt dabei juristische und pseudo-juristische Begriffe nach Belieben.
Fachkenntnisse, ach Fachkenntnisse — darf man denn so etwas von Journalisten heutzutage noch erwarten? Teilweise muss die Leserschaft ja schon froh sein, wenn die Betreffenden einen geraden Satz hinkriegen.
Teilweise leiden die journalistischen Kindersoldaten auch noch an Kinderkrankheiten — zum Beispiel Gregory Feger. Doch sei es ihnen nachgesehen: Es ist normal, dass Jugendliche Kinderkrankheiten durchmachen — peinlicher ist es hingegen, wenn Erwachsene noch an Kinderkrankheiten leiden. In diesem Sinn sei ihm seine SP-Mitgliedschaft verziehen — mit zunehmendem Alter wird auch er zweifellos noch vernünftiger werden.
Aus dem Pulk der Kindersoldaten positiv heraus ragte bislang Léonie Hagen mit einer durchaus ordentlichen Schreibe. Es überrascht, dass sie sich nach einer gefühlt halben Ewigkeit immer noch mit dem Prekariat, welches mit der Funktionsbezeichnung «Stagaire» einhergeht, abfinden mag.
Unlängst fasste sie gar den Auftrag, der Leserschaft ein Urteil des Bundesgerichts, welches in französischer Sprache erging, zu erklären. Diese Hürde erwies sich allerdings auch für sie als etwas zu hoch.
Das Bundesgericht pflegt seiner Urteile mit folgender Formel zu schliessen: «Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.» Abweisung ist am Bundesgericht dabei der Regelfall. Manchmal wird diese Formel auch verkürzt zu: «Die Beschwerde wird abgewiesen.»
Das Pendant in französischer Sprache lautet dabei: «Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.» Oder im Fall des Urteils 7B_418/2023 – sollte Léonie Hagen darauf aspirieren, auch einmal bei der NZZ zu arbeiten, sollte sie es sich angewöhnen, die Nummer des Urteils jeweils gleich mitzuliefern – kurz: «Le recours est rejeté.»
Und das übersetzt man dann eben mit: «Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab». Und nicht etwa mit: «Das Bundesgericht weist die Beschwerde zurück» — womöglich gar noch «entrüstet».
Es ist auch normal, dass ein Beschwerdeführer verschiedenen Punkte eines Urteils der Vorinstanz rügt, welches er mit seiner Beschwerde anficht. Je mehr Punkte er rügt, desto grösser die Chance, dass er wenigstens in einem davon recht erhält. Dies aber immer im Rahmen dieser einen Beschwerde, welche Gegenstand des bundesgerichtlichen Verfahrens und Urteils bildet.
Wo es in der Sache um verschiedene vorgebrachte Rügen geht, werden daraus bei Léonie Hagen plötzlich «Beschwerden»: «Beide Beschwerden hat das Bundesgericht ebenfalls abgewiesen.» Und der Leser fragt sich, ob er wohl etwas überlesen hat — ob da noch über andere Beschwerden berichtet wurde, welche seiner Aufmerksamkeit entgangen sind.
Doch nein, die mangelnde Aufmerksamkeit liegt in diesem Fall alleine auf Seiten der Journalistin. Teil der Recherche für einen Beitrag wäre durchaus, zu recherchieren, wie man etwas fachgerecht auf Deutsch sagt. Dafür gibt es jede Menge Bundesgerichtsentscheide — man müsste nur kurz reinschauen.
Auf derselben Doppelseite dürfte auch noch die Online-Redaktorin Hildegard Wyss ran. Trotz des klassisch teutonisch klingenden Vornamens insistierte sie dabei darauf, das Verb «sich belaufen» nicht mit der Präposition «auf» sondern «bei» zu kombinieren.
Auch sie mutmasslich ein Opfer der im Journalismus weit verbreiteten Manie, die verwendeten Wörter immer schön zu variieren. Was dann nur zu oft zu berühmt-berüchtigten Stilblüten führte: «der Mann aus Sursee» (anstelle von Haris Seferovic) oder «die Trübbacherin» (anstelle von Martina Hingis).
Offensichtlich fand sie beim Kontrolllesen ihres Texts, dass sie zu oft «lag der Anteil bei» schrieb. Also ersetzte sie einige dieser Formulierungen durch «belief sich der Anteil» — das «bei» allerdings, das blieb dabei.
In diesem Sinne: Bye bye, bis zum nächsten «bei».












