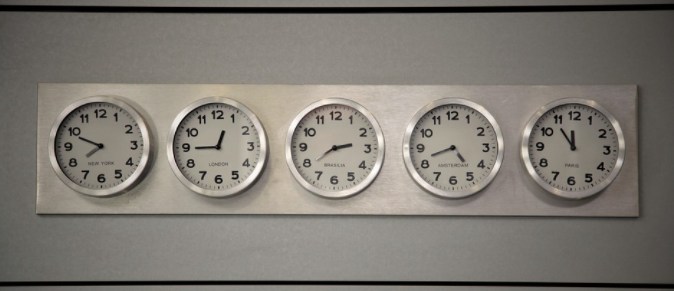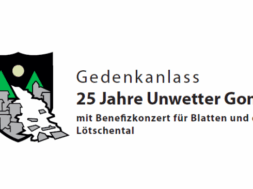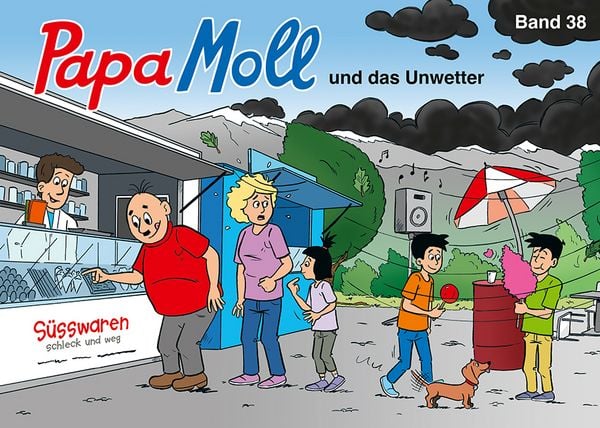Mattmark 1965–2025 – Tragödie in den BergenKulturzentrum Sonnenhalde in Saas-Grund mit Ausstellung
Am 30. August 1965 erschütterte eine der schwersten Katastrophen der Schweizer Baugeschichte das Wallis.
Ein Gletscherabbruch am Allalingletscher begrub 88 Menschen unter Millionen Tonnen Eis und Geröll – eine Tragödie, die bis heute Fragen aufwirft.
Am Freitagabend, dem 25. Juli 2025 ab 18:00 Uhr beginnt eine Ausstellung zum tragischen Ereignis von 1965, das aktuell jährt.
Anläßlich des 60. Jahrestags der Katastrophe von Mattmark laden die Vereinigung ItalienWallis und das Ad hoc-Komitee Mattmark 2025 herzlich zur Vernissage der Fotoausstellung ein.
Das Unglück
Kurz vor 17.20 Uhr brach ein gewaltiges Stück des Allalingletschers über der Baustelle des Mattmark-Staudamms im Saastal ab. Zwei Millionen Kubikmeter Eis und Schutt donnerten auf die Barackensiedlung, in der sich Arbeiter aufhielten.
Die Baracken, Werkstätten und die Kantine lagen direkt in der Fallinie, obwohl Warnsignale ignoriert worden waren.
Die Suva, die seitdem nun härtere Bauvorschriften durchsetzte berichtet über das Unglück:
«Es war, als ob der Eisberg vom Himmel fiel.» Er habe nur überlebt, so ein Arbeiter, weil ihn die Druckwelle der Eislawine zu Boden geschleudert habe. Ein anderer Arbeiter berichtete von einem «fürchterlichen Windstoß», dann seien die Kameraden «wie Schmetterlinge davongeflattert». Es habe ein großes Donnern gegeben, «und dann war Schluss». Menschen, Lastwagen und Planierraupen seien durch die Luft geflogen.
Was sich an diesem 30. August 1965 ereignete, mutete wie der Weltuntergang an. So schilderte es ein Überlebender. Kurz vor dem Schichtende, um 17.20 Uhr, geschah es: Ein gewaltiges Stück des Allalingletschers brach von der Gletscherzunge ab, eine verheerende Lawine aus Eis und Geröll – rund zwei Millionen Kubikmeter – stürzte auf die Baracken, Werkstätten und die Kantine der Mattmark-Baustelle.

Glück im Unglück
Die Suva berichtet weiter, man habe damals sogar von Glück gesprochen: Trotz der unfaßbaren Tragweite sprach man auch von Glück: Hätte sich die Katastrophe nur eine halbe Stunde später – nach dem Schichtende – ereignet, hätten sich bis zu 700 Arbeiter in den Mattmark-Baracken aufgehalten.
88 Tote
86 Männer und zwei Frauen – darunter 56 Italiener, 23 Schweizer, 4 Spanier, 2 Deutsche, 2 Österreicher und 1 Staatenloser – fanden den Tod.
Nur wenige überlebten, darunter ein Bulldozerfahrer, der sich hinter seiner Maschine schützen konnte.
Ursachen und Kontroverse
Offiziell wurde das Unglück als unvorhersehbare Naturkatastrophe dargestellt. Doch Stimmen warnten schon vorher vor Gletscherabbrüchen, die von der Bauleitung und den Verantwortlichen der Elektro-Watt AG offenbar übergangen wurden.
Die Dringlichkeit, den Staudamm vor dem Winter fertigzustellen, schien Vorrang vor der Sicherheit gehabt zu haben.
Anklage wegen fahrlässiger Tötung
17 Personen wurden der fahrlässigen Tötung angeklagt – darunter auch Ingenieure und 2 Suva-Mitarbeiter. Sie wurden von den Gerichten freigesprochen, da eine Eislawine als zu unwahrscheinlich galt.
Eine spätere Studie der Universität Genf legt jedoch nahe, daß die Katastrophe vermeidbar gewesen sein könnte, wenn Warnungen ernst-genommen worden wären.
Bei Blatten stehen diese Untersuchungen noch aus. Hier kam ein Mensch ums Leben, weil die Gefahrenzone zu klein eingeschätzt wurde. Im Gegensatz zu anfänglichen Gerüchten hielt sich der getötete Bauer außerhalb der Gefahrenzone auf.
Nachwirkungen
Die Mattmark-Katastrophe löste weltweit Empörung aus, besonders in Italien, von wo die meisten Opfer stammen. Angehörige und die italienische Presse kritisierten die Arbeitsbedingungen und die Platzierung der Baracken.
Das Urteil führte zu Protesten, und die Familien der Opfer mußten teilweise Gerichtskosten tragen, was das Bild einer „hartherzigen Schweiz“ verstärkte.
Die Tragödie prägte die Migrationsgeschichte und führte langfristig zu strengeren Sicherheitsvorschriften im Baugewerbe.
Erinnerung
Heute erinnert ein Gedenkstein am Staudamm an die Opfer. Die Mattmark-Katastrophe bleibt ein Mahnmal für die Balance zwischen wirtschaftlichem Fortschritt und menschlichem Leben – und wirft die Frage auf, ob Profit damals über Vorsicht siegte.
(pd, rm)
(Bild: Situation nach dem Gletscherabbruch. Versuchsanstalt für Waserbau, Hydrologie und Glaziologie)