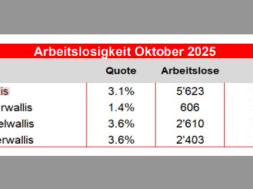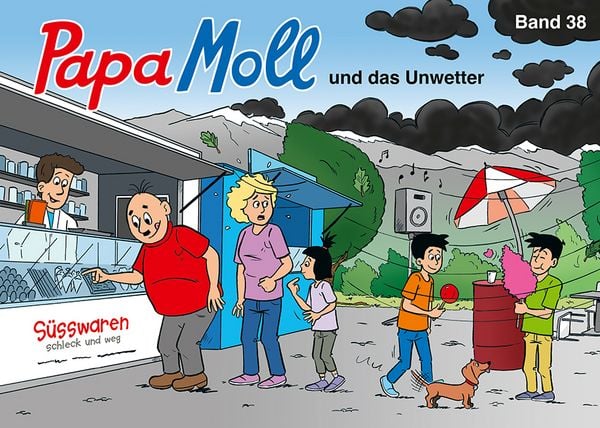Motion Beat Rieder: Keine Volksabstimmungen im Krisenfall?
Der Bundesrat will eine Motion des Walliser Ständerats Beat Rieder umsetzen. Diese Motion hat es in sich und dürfte einige Wellen schlagen und zu Protesten führen. Volksabstimmungen sollen „im Krisenfall“, also genau dann, wenn sie am Nötigsten sind, „verschoben“ oder gar „abgesagt“ werden.
In der Schweiz gab es etwa zwei Volksabstimmungen über die Corona-Zwangsmaßnahmen als der Bundesrat via Notrecht herrschte. Aufgrund von rund 40% Stimmenanteil von Abstimmenden, die die harten Zwangsmaßnahmen ablehnten hatte die Schweiz in der Folge weniger harte Corona-Maßnahmen als etwa die bei den Maßnahmen extremen Nachbarländer Deutschland oder Österreich.
Werden solche Volksabstimmungen dies in Zukunft im Krisenfall nicht mehr möglich sein?
Der Bundesrat will eine gesetzliche Grundlage erarbeiten für „die Verschiebung beziehungsweise Absage einer bereits angesetzten Volksabstimmung im Krisenfall.“
Er hat an seiner Sitzung vom 22. Februar 2023 die Eckwerte für eine Vernehmlassungsvorlage festgelegt. Mit der Vorlage soll auch weiterer Revisionsbedarf im Bereich der politischen Rechte berücksichtigt werden.
Eine neue Kompetenz des Bundesrates zur Absage beziehungsweise Verschiebung einer Volksabstimmung soll explizit im Bundesgesetz über die politischen Rechte (BPR; SR 161.1) erfaßt werden.
Das Gesetz soll auch die für einen solchen Entscheid zulässigen Gründe festhalten.
Eine Absage oder Verschiebung soll dann möglich sein, wenn aufgrund von unmittelbar drohenden oder bereits eingetretenen, schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Organisation der Abstimmung (Abstimmungslogistik, Stimmabgabe, Auszählung) oder der Meinungsbildung die Abstimmung nicht ordnungsgemäss durchgeführt werden kann.
Es fragt sich, was denn eine unmittelbar drohende oder bereits eingetretende schwerwiegende Beeinträchtigung der Meinungsbildung sein soll?
Also wenn Leute auf die Straßen gehen und demonstrieren? Wenn die Stimmung in sozialen Medien hochkocht? Oder was kann damit sonst gemeint sein?
Mit der geplanten Gesetzesänderug habe der Bundesrat die Eckwerte für die Umsetzung der Motion 20.3419 Rieder festgelegt. so heißt es in der Mitteilung des Bundesrats. Er habe die Bundeskanzlei beauftragt, eine Vernehmlassungsvorlage für eine entsprechende Teilrevision des BPR auszuarbeiten.
Weiterer Revisionsbedarf im Bereich der politischen Rechte
Die geplante Vernehmlassungsvorlage wird zudem weiteren Revisionsbedarf im Bereich der politischen Rechte berücksichtigen. So sollen etwa die Voraussetzungen für den Einsatz sogenannter Abstimmungsschablonen durch Menschen mit einer Sehbehinderung (Umsetzung Motion 22.3371) geschaffen werden.
Abstimmungen im Frühjahr sollen nach hinten geschoben werden
Zudem will der Bundesrat die Regeln für die Bestimmung der Abstimmungstermine des Bundes dahingehend anpassen, dass eidgenössische Abstimmungen nicht bereits am zweiten Februarsonntag stattfinden können. Der Abstimmungstermin im Frühjahr soll künftig generell einige Wochen später zu liegen kommen.
Die Eröffnung der Vernehmlassung ist für Ende 2023 vorgesehen.
Die Motion Rieder
Die Motion Rieder lautet:
„Der Bundesrat wird beauftragt, Massnahmen zu ergreifen damit die Handlungsfähigkeit des Staates sowie die Ausübung der demokratischen Rechte auf allen staatlichen Ebenen unter Wahrung des Föderalismus auch in Krisenzeiten gewährleistet sind. Der Bundesrat soll unter anderem in folgenden Bereichen Massnahmen ergreifen:
1. Der Stillstand von politischen Fristen, sowie das Verschieben von Volksabstimmungen und Wahlen sollen in einem ordentlichen Bundesgesetz geregelt werden.
2. Der Bundesrat soll die digitale Kompetenz in allen drei Gewalten fördern und damit auch die Ausübung der direkten Demokratie sicherstellen.“
Die Begründung der Motion:
„Durch die COVID-19-Pandemie wurde unser demokratisches System abrupt ausgebremst. Der Bundesrat regiert mittels Notverordnungen, Wahlen und Abstimmungen wurden aufgeschoben, Fristen stehen still, das Sammeln von Unterschriften ist verboten. Durch das Versammlungsverbot ist die politische Meinungsbildung auf allen politischen Ebenen zusätzlich erschwert. Die Massnahmen scheinen aufgrund der Schwere der Lage vertretbar. Dennoch muss schnellstmöglich ein Weg gefunden werden, wie die Ausübung der demokratischen Rechte auf allen staatlichen Ebenen wieder gewährleistet ist. Wichtige oder zeitkritische Geschäfte müssen besonders vom Parlament und den Kommissionen jederzeit rechtsgültig und verbindlich beraten werden können. Dies gilt besonders im Hinblick auf Ausnahmesituationen, in welchen ein physisches Zusammenkommen gänzlich verunmöglicht ist. Dabei soll ein Weg die Förderung der digitalen Kompetenz sowie der digitalen Bereitschaft (eReadiness) des politischen Systems wie auch der Verwaltung sein.“
Die Stellungnahme des Bundesrats:
„1. Die Festlegung der Vorlagen und die Anordnung einer eidg. Volksabstimmung sind Aufgaben des Bundesrates (Art. 10 des Bundesgesetzes über die politischen Rechte, BPR, SR 161.1). Für die Volksabstimmungen stehen rechtlich bestimmte „Blankotermine“ zur Verfügung (Art. 10 Abs. 1 BPR i. V. m. Art. 2a der Verordnung über die politischen Rechte, VPR, SR 161.11), die der Bundesrat „aus überwiegenden Gründen“ verschieben oder ergänzend zu denen er zusätzliche Termine festlegen kann (Art. 2a Abs. 2 VPR). Als oberste leitende und vollziehende Behörde ist der Bundesrat für ordnungsgemässe eidg. Volksabstimmungen verantwortlich und kann im Rahmen seiner Kompetenzen eine angesetzte Volksabstimmung nötigenfalls absagen, wie er das zuletzt mit der Volksabstimmung vom 17. Mai 2020 gemacht hat. Angesichts der Konsequenzen für die politischen Akteure und die Gemeinwesen aller Stufen sind an eine Absage aber strenge Bedingungen zu stellen.
In Bezug auf die Nationalratswahlen sind die gesetzgeberischen Möglichkeiten für eine Verschiebung verfassungsrechtlich beschränkt: Die Dauer der Legislaturperiode ist in Artikel 149 Absatz 2 der Bundesverfassung (BV, SR 101) auf vier Jahre festgelegt; eine Verkürzung ist ausschliesslich im Fall einer beschlossenen Totalrevision der BV vorgesehen (Art. 193 Abs. 3 BV). Als Wahltag für die ordentliche Gesamterneuerung bestimmt das Gesetz den zweitletzten Sonntag im Oktober (Art. 19 Abs. 1 BPR).
Ähnliches gilt für die in der BV geregelten Fristen für das Sammeln von Unterschriften für eidg. Volksinitiativen und fakultative Referenden (Art. 138 Abs. 1, Art. 139 Abs. 1, Art. 141 Abs. 1 BV). Um die verfassungsrechtlichen Fristen respektieren zu können, sah die Verordnung über den Fristenstillstand bei eidg. Volksbegehren (AS 2020 847) vor, dass während des Fristenstillstands keine Unterschriften gesammelt werden dürfen. Diese Einschränkung des Initiativ- und Referendumsrechts ist ein erheblicher Eingriff, der durch die schwere Störung der öffentlichen Ordnung gerechtfertigt war. Ob eine verschlechterte epidemiologische Lage und verschärfte behördliche Massnahmen einen erneuten Fristenstillstand rechtfertigen würden, ist indes fraglich. Sowohl die Behörden als auch die politischen Akteure konnten sich in der Zwischenzeit auf die Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit der Covid-19-Epidemie einstellen und vorbereiten. Ist das Parlament beschlussfähig, müssen auch die Volksrechte ausgeübt werden können.
Nach Auffassung des Bundesrates besteht im Bereich der Ausübung der politischen Rechte kein unmittelbarer gesetzgeberischer Handlungsbedarf. Krisenbeständige demokratische Verfahren sind aber unverzichtbar. Die bestehenden Prozesse rund um die Durchführung von Volksabstimmungen und Wahlen sowie die Ausübung der Volksrechte sind deshalb vor dem Hintergrund der Covid-19-Epidemie zu überprüfen. Dabei ist den Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten der Kantone und Gemeinden Rechnung zu tragen.
2. Eine hohe digitale Kompetenz aller Behörden auf allen staatlichen Ebenen ist ein wichtiges Anliegen. Im Sinne der Selbstorganisation ist dies in erster Linie Aufgabe jedes Gemeinwesens respektive jeder Behörde selbst. Der Bund fördert die Digitalisierung auf der horizontalen und der vertikalen Ebene bereits, indem er gemeinsame Ansätze z. B. im Bereich „Digitale Verwaltung“ oder „E-Justice“ fördert. Um die Digitalisierung der Bundesverwaltung voranzutreiben, hat der Bundesrat jüngst eine Neuorganisation beschlossen. Per 1. Januar 2021 wird der bei der Bundeskanzlei angesiedelte Bereich für die „Digitale Transformation und IKT-Lenkung (DTI)“ geschaffen.“
(rm)