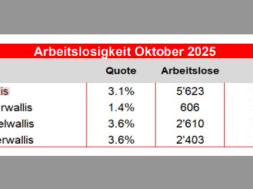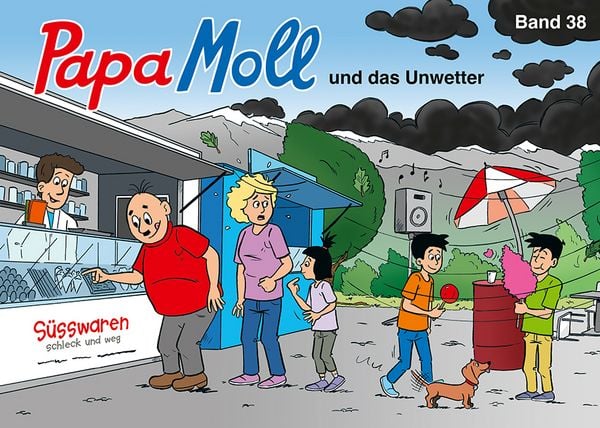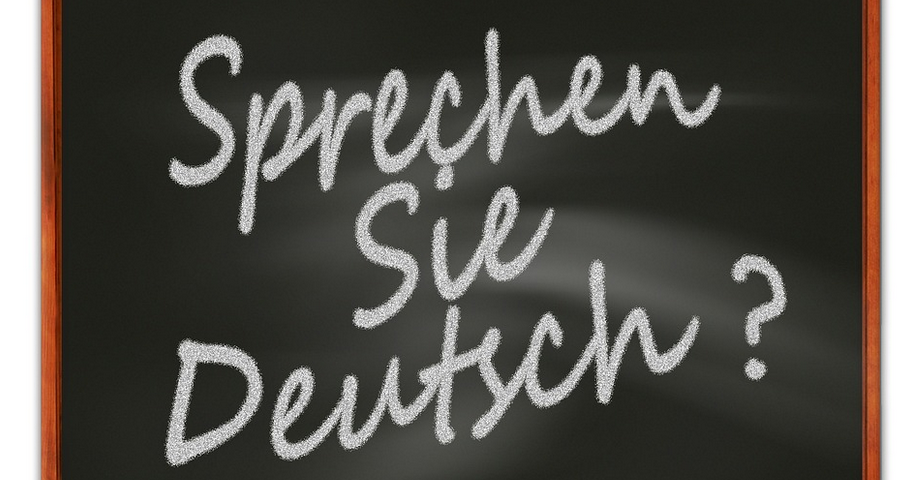
Neue Nebenwirkung von Corona gefunden:
Kolumne von Thomas Baumenn, Ökonom und Freier Autor (u.a. Tagesanzeiger, NZZ, Weltwoche)
In doppelseitigen Inseraten in der Oberwalliser Presse versuchte die Kantonsverwaltung während der nationalen Impfwoche, die noch nicht Geimpften zum Impfen zu bewegen. Um diese der Impfung mehrheitlich skeptisch gegenüberstehenden Personen zu überzeugen, bediente sich die Verwaltung selbstverständlich einer besonders stringenten, überzeugenden Argumentation – könnte man meinen. Doch offenbar hat Covid-19 noch andere Folgen als Fieber, Kurzatmigkeit, Verlust von Geruchs- und Geschmacksinn usw. Auch ein Verlust der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit scheint eine Folge dieser Pandemie zu sein. Ob dieser vor allem auf Homeoffice oder andere Gründe zurückzuführen ist, muss allerdings vorerst offen bleiben. Also belehrt uns der Kanton:
„Schliesslich beugt die Impfung Langzeitfolgen von COVID-19 (Long Covid) vor, die Monate nach der Infektion Symptome wie Verlust von Geschmacks- oder Geruchssinn, Husten, Müdigkeit, Kopfschmerzen oder Kurzatmigkeit verursachen.“
Na ja, diese Symptome sind ja gerade die Langzeitfolgen. Denn was jene hervorruft, weiss man bisher noch nicht. Daher ist es rein spekulativ, von Langzeitfolgen zu sprechen, die etwas anderes sein sollen als ebendiese Symptome. Zudem drückt sich der Kanton nicht präzise aus, ob die Langzeitfolgen nach der Infektion einfach andauern – oder später plötzlich auftreten. Sollte die Verwaltung letzteres meinen, dann wäre dies argumentativ geradezu ein trojanischer Pferd. Denn wenn es möglich ist, dass nach einer Infektion mit dem Coronavirus Monate später plötzlich Symptome auftreten, dann stellt sich die Frage, warum das bei einer Impfung theoretisch nicht möglich sein sollte. Das argumentative Tor für die Impfgegner wäre weit geöffnet.
„Die Sicherheit der Impfstoffe wird engmaschig und kontinuierlich kontrolliert. Bislang machen die schweren Fälle in der Schweiz 0.056% der Personen aus, die mindestens eine Dosis erhalten haben. Das Risiko schwerwiegender unerwünschter Impferscheinungen ist statistisch gesehen viel geringer als bei einer COVID-Infektion.“
Welche Art von „schweren Fällen“? Schwere Fälle von Impfnebenwirkungen – oder schwere Verläufe nach einer Infektion? Doch ganz abgesehen davon: Das Risiko schwerwiegender unerwünschter Impferscheinungen kann es trivialerweise ja nur nach einer Impfung geben und nicht nach einer COVID-Infektion. Der ganze Unsinn der Argumentation zeigt sich, wenn man einmal „Impfung“ durch „Erdbeeren“ und „COVID-Infektion“ durch „Aprikosen“ ersetzt: „Das Risiko einer unerwünschten Erdbeerallergie ist nach dem Konsum von Erdbeeren statistisch gesehen viel geringer als nach dem Konsum von Aprikosen.“ Diese Logik sollte uns der Kanton bei Gelegenheit einmal erklären.
„Es ist wichtig zu wissen, dass Frauen mit COVID-19 nach der Infektion häufig stärkere und unregelmässigere Blutungen haben. Es ist noch nicht erwiesen, ob diese Veränderungen auf die Infektion oder die Impfung zurückzuführen sind. Sie können auch auf andere Faktoren wie Stress zurückzuführen sein.“
Arme Frauen! Sie müssen sich nicht nur jeden Monat mit der Mens herumschlagen, sondern auch noch mit den mangelnden Sprachfähigkeiten der Kantonsverwaltung. Dabei ist es doch ganz einfach: Wenn eine Frau nach einer Infektion dem Coronavirus stärkere und unregelmässigere Blutungen hat, dann ist das nach Adam Riese ja wohl auf die Infektion zurückzuführen. Oder machen wir nochmals das Beispiel mit den Erdbeeren und den Aprikosen. Wenn jemand nach dem Verzehr von Erdbeeren Durchfall hat, dann liegt das ja wohl an den Erdbeeren – und nicht am Verzehr von Aprikosen letzter Woche. Allerdings ist nicht ausgeschlossen, dass stärkere Blutungen bei sprachlich sensiblen Frauen tatsächlich eine Nebenwirkung von Stress ist, den diese beim Lesen dieses Inserats befällt.
Die Lehr von der Geschicht: Wer andere überzeugen will, sollte sich wenigstens darum bemühen, sich sprachlich präzise auszudrücken. Denn wenn die Übersetzung aus dem Französischen so wirkt, als stamme sie unverändert aus Google Translate – dann fragt man sich unweigerlich, ob die Argumente ebenfalls von Google stammen. Vertrauen schafft man so sicher nicht.
- Zuwenig Regen: Waldbrandgefahr im Wallis
Aufruf zur Vorsicht
- Juli 26, 2024 - Gemeinderats-Wahlen Leuk: SVP Leuk mit breit abgestützter 5er-Liste
Patrick Kuonen, Thierry Zwahlen, Bernardo Amacker, Nevio Imhasly und Sascha Gsponer stellen sich zur Wahl
- Juli 26, 2024 - Zurück vor heimischem Publikum
Der FC Sion empfängt Lausanne-Sport
- Juli 26, 2024