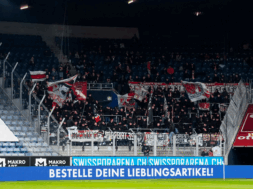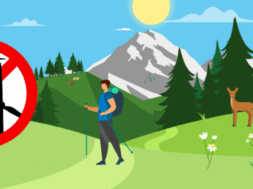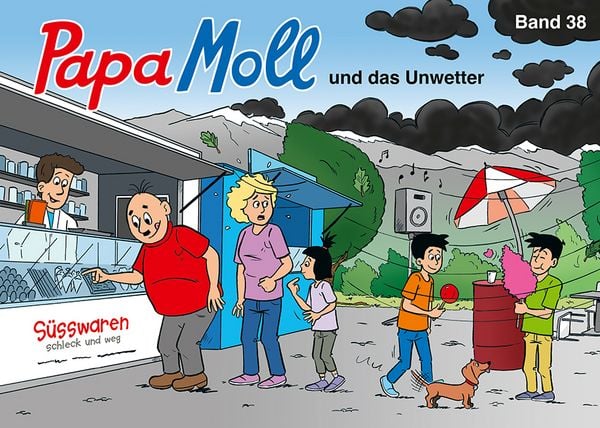Putins Provokationen müssen von der NATO beantwortet werden
Ein Meinungsbeitrag von Roger E. Schärer
Russland testet im osteuropäischen Raum mehr denn je die Grenzen, wie weit Putin mit Drohnen- und Kampfjet-Provokationen die Reaktionen und die Handlungsfähigkeit der NATO – eines Verteidigungsbündnisses westlicher demokratischer Staaten – austesten kann. Eigentlich ein übliches Provokationsmanöver Russlands.
Laut NATO Air Policing fingen NATO-Kampfjets 2022 und 2023 über 300 russische Kampfflugzeuge ab, die sich dem Luftraum des Bündnisses bedrohlich näherten.
Der ehemalige Luftwaffenchef hat recht
Ein ehemaliger skandalfreier ehemaliger schweizerischer Luftwaffenchef hat recht. Unsere Luftabwehr könnte ein russisches Eindringen von Drohnen nicht abwehren. Putins 19 Drohnen über Polen ohne Sprengladungen, Kampfjets über Estland und Rumänien, Erkundungsflüge über europäische Flughäfen, gehackte Flughafensysteme und das Verursachen von Chaos sind taktisch beeindruckende Manöver und eine brillante Krisenregie eines ausgebildeten ehemaligen Geheimdienstoffiziers.
Putins Strategie als Geheimdienstoffizier
Er agiert auch als Präsident, der vom Internationalen Strafgerichtshof als Kriegsverbrecher verfolgt wird, nach gelernten Mustern. Geheimdienst heisst immer wieder Grenzen überschreiten, Risiken bei Provokationen genau limitieren und einschätzen, minimalen Schaden in Kauf nehmen, hinterhältig verdeckt rote Linien kalkulierend überschreiten, strategische Ziele langfristig erreichen und Chaos und überstürzte Reaktionen mit politischen, hybriden und desinformativen Mitteln erzielen.
Fake News begleiten Putins Provokationen und verunsichern. Dann alles leugnen und dementieren und die Aktionen gegen Europa ohne eigenen politischen oder wirtschaftlichen Kollateralschaden weiter verfolgen. Wenn Putin Drohnen ohne Sprengstoff in NATO-Nachbarländer Polen und Rumänien eindringen lässt, plant er genau diese hektischen sicherheits- und aussenpolitischen Reaktionen.
Die übertriebenen Reaktionen des Westens
50 Millionen Kampfjets Deutschlands und Polens schiesst 20 000 Dollar teure Drohnen ab. Die NATO tagt, verlegt drohend und mässig dissuasiv Tausende von Truppen an Russlands Grenze, die UNO macht dringende Sicherheitsratsitzungen mit üblichen wirkungslosen Verlautbarungen, neue Sanktionen in neunter Auflage werden angedroht.
Verhältnismässigkeit, eine sorgfältigere Bedrohungsanalyse und abschreckendere Massnahmen unterhalb der Kriegsschwelle wären nötiger. Brüssel tagt, droht und berät. Ohne Einstimmigkeit können Russlands auf europäischen Konten lagernde Devisenreserven über 160 Milliarden Euro nicht einfach beschlagnahmt werden.
Demokratische Hürden vs. Diktatur
Diktator Putin kann ohne demokratische Kontroll- und Oppositionskorrektive seine Strategie durchsetzen. Die EU-, NATO-Länder und Mitgliedstaaten sind demokratisch aufgestellte Staaten. Mehrheiten und parlamentarische Oppositionen schränken die Entscheidungs- und Handlungsfreiheit enorm ein. Die politischen Entscheidungsprozesse werden zeitlich verzögert. Ungarns Orbán und Sloweniens Fico als Putins Sympathisanten sind notorische EU-Stänkerer und profitieren wirtschaftlich von Russlands bevorzugten Energielieferungen.
Putins Kalibrierung unter der Kriegsschwelle
Putin testet nicht nur die möglichen militärischen Reaktionen aus, sondern auch die politischen. Es leuchtet strategisch ein, dass Putin die Provokationen so kalibriert, dass diese immer unter der Kriegsschwelle bleiben. Einen Krieg kann sich Putins wirtschaftliche Lage – Russlands mit höchster Inflation, fehlenden Energieeinnahmen, eingeschränkter ziviler Güterproduktion und zunehmender Kriegsermüdung des Volkes trotz enormer Durchhaltepropaganda für die Spezialoperationen in der Ukraine – nicht leisten.
Schon gar nicht den Supergau atomarer Kriege. Auch die hochverschuldeten Staaten Europas mit unmotivierter, verteidigungsunfähiger Bevölkerung sind an einem Krieg nicht interessiert. Auch Präsident Trump, der den Friedensnobelpreis möchte, wird während seiner Amtszeit einen Krieg verhindern. Putin wird seine taktischen Provokationsspielchen weiter betreiben, um sich wie alle alten diktatorischen Despoten Xi Jinping, Trump, Erdogan, Lukaschenko und Netanjahu an der Macht zu halten.
Mögliche Gegenmaßnahmen
Gegenmassnahmen müssen und können möglich sein. Die NATO, Polen und Rumänien müssten unbewaffnete Drohnen nach Russland fliegen lassen, um Reaktionen Russlands zu testen. Oder von der Ukraine lernen, die den Drohnenkrieg kann und eine eigene wirkungsvolle Drohnenproduktion aufgenommen hat. Die Ukraine ist bereit, der NATO ihre beeindruckenden Erfahrungen und Fortschritte im Drohnenkrieg weiterzugeben.
Schweizer Perspektive
Es gibt schweizerische politische Stimmen, die vor Drohnen oder Kampfjets über der Schweiz warnen. Moskau wird die Schweiz als neutrales Land nie angreifen. Auch wenn wir in Reichweite russischer Raketen liegen. So lange Polen über fünf Prozent seines Bruttosozialprodukts für Rüstung und Armee ausgibt und einen starken Abwehrriegel gegen russische territoriale Angriffe hält, kommt Putins marode Armee nicht einmal über Kiew hinaus. Das sind bedrohungsmässig entscheidende Erkenntnisse für unsere schweizerische Aufrüstung.
Die einzige Antwort Europas ist die Errichtung eines Drohnenwalls gegen den neuen eisernen Vorhang. Auch beim Abschuss eines russischen Jets über NATO-Territorium könnte es sich Putin nicht leisten, Krieg zu beginnen. Mehrere NATO-Staaten wie Tschechien, Polen und die USA stellen sich auf den Standpunkt, diese bei Verletzungen des Luftraums auch abzuschiesst. Der tschechische Staatspräsident Petr Pavel war hoher NATO-General in Brüssels Hauptquartier.
Empfehlungen für die schweizerische Sicherheitspolitik
Für die schweizerische Sicherheitspolitik heisst das: Keine überteuerten F-35 gegen Drohnen einsetzen, sondern unverzüglich ein kostengünstiges, funktionsfähiges Drohnenabwehrsystem entwickeln. Das skandalöse israelische Drohnen-Debakel, das bisher 300 Millionen durch ein unsorgfältiges Beschaffungsprojekt der schweizerischen Beschaffer Armasuisse im VBS gekostet hat, ist abzuschreiben und die Drohnenabwehr international zu koordinieren. Luft- und Cyberabwehr sind zu priorisieren. Die 100 Milliarden, die unsere Panzeroffiziere irrlichternd forderten, sind ein schlechter Witz. Die Pattons haben ausgedient und die grossen Panzerschlachten sind nur noch im Kino zu erleben. Leider hat alte Bundesrätin Amherd diese Prioritäten nicht umgesetzt, keine sorgfältige Bedrohungsanalyse durchführen lassen und unseren Nachrichtendienst an die Wand gefahren. Als Putin die Ukraine angriff, stand die VBS-Chefin ohne Nachrichtendienstchef da. Sie blamierte den Bundesrat und die Schweiz. Unter diffusen persönlichen unsäglichsten Umständen entliess sie den besten, erfahrensten Direktor des NDB. Dieser war 8 Jahre militärischer Nachrichtendienstchef. Dann liess Amherd über einen Headhunter einen Nachfolger suchen. Dieser war Botschafter und kam aus dem EMD. Auch da hätte man dieses Honorar wie auch das für überteuerte Gutachten einer prominenten Zürcher Anwaltskanzlei uns Steuerzahlern ersparen können. Eine weitere amherdsche Amigokultur. Die Anwältin ist die Tochter eines bekannten walliserischen politischen Strippenziehers.
Potenzial der schweizerischen Industrie
Die ETH verfügt über hervorragende Drohnenforscher. Diese entwickelten hochqualitative Drohnen für die Standortbestimmung von Windkraftwerken in Europa. Diese flogen über Wochen problemlos und erfüllten ihre Aufgaben mit gewohnter schweizerischer Qualität. Der schweizerische Werk- und Denkplatz sind für den Bau dazu in der Lage. Drohnen sind ein hochqualitatives Exportprodukt für unseren auslandmarktorientierten Industriestandort Schweiz. Das beweisen die erfolgreich produzierten Pilatus-Flugzeuge. Wenn die schweizerische Industrie solche weltweit eingesetzten Flugzeuge herstellen kann, wird sie auch Drohnen produzieren können. Das haben vorausschauende sicherheitspolitische Kräfte in Armee und Parlament schon seit Jahrzehnten eingefordert.
Roger E. Schärer, Oberst a D, Direktion Sicherheitspolitik VBS,
ehemaliger Berater NDB