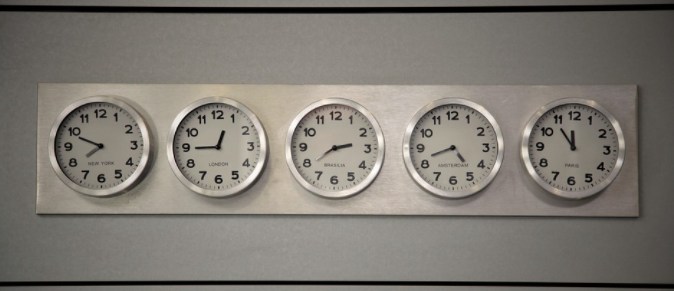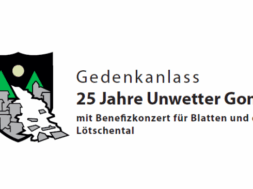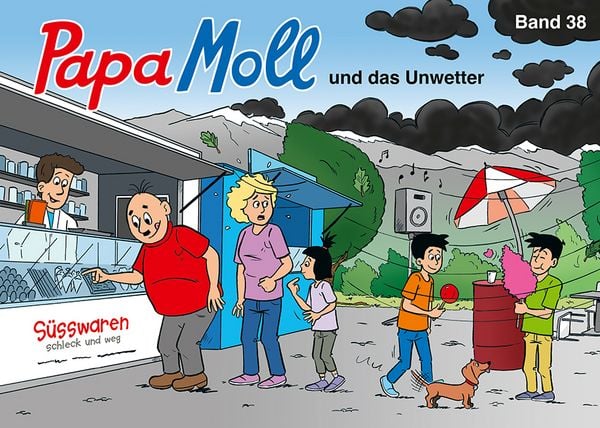Saisonaler Pollenflug und LuftqualitätWarum Allergien in der Schweiz immer schlimmer werden
Mit dem Frühling kehrt die Vegetation zurück – und mit ihr eine zunehmend belastende Phase für Menschen mit Pollenallergien und Asthma. In den letzten Jahren haben sich die Bedingungen für Betroffene auch in der Schweiz spürbar verschlechtert. Eine Kombination aus veränderten Blühperioden, steigenden Pollenmengen und schwankender Luftqualität sorgt vielerorts für intensivere und längere Symptome.
Frühere und längere Pollensaison
Zahlreiche Studien sowie Messdaten von MeteoSchweiz zeigen: Der Klimawandel wirkt sich messbar auf den Blühkalender aus. Viele Pflanzen beginnen früher zu blühen und setzen mehr Pollen frei. Laut dem Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie hat sich beispielsweise die Pollensaison von Birken und Eschen in den letzten zwei Jahrzehnten um bis zu drei Wochen nach vorne verschoben. Auch Gräser beginnen im Durchschnitt rund zehn Tage früher zu blühen. Gleichzeitig wurde eine Verlängerung der Pollenflugdauer beobachtet – teilweise bis in den Herbst hinein.
Es wird dabei zumeist vermutet, dass die wärmeren Frühjahre sowie veränderte Feuchtigkeitsverhältnisse als für die Ausdehnung der Pollensaison verantwortlich sind. Pflanzenarten wie die Birke oder die aus Nordamerika eingeschleppte Ambrosia reagieren empfindlich auf klimatische Veränderungen und produzieren unter wärmeren Bedingungen mehr Pollen.
Allergien und Asthma: Eine zunehmende Belastung
Etwa 20 Prozent der Bevölkerung in der Schweiz sind von einer Pollenallergie betroffen. Besonders problematisch ist die sogenannte allergische Rhinitis, die bei unzureichender Behandlung in ein allergisches Asthma übergehen kann. Dabei verengen sich die Bronchien, was zu Symptomen wie Atemnot, Husten, Engegefühl in der Brust und pfeifender Atmung führen kann.
Diese Symptome verstärken sich, wenn hohe Pollenwerte mit ungünstigen Umweltbedingungen zusammentreffen. Ein relevanter Faktor ist die Luftqualität. Zwar gilt die Luft in der Schweiz im internationalen Vergleich als relativ sauber, doch auch hier treten regelmässig Belastungsspitzen auf – etwa durch Feinstaub, Ozon oder Stickstoffdioxid. Besonders in verkehrsreichen Regionen und bei Inversionswetterlagen kommt es zu erhöhten Schadstoffkonzentrationen, die in Kombination mit Pollen die Atemwege zusätzlich reizen.
Betroffene Regionen und Risikogruppen
Besonders gefährdet sind Städte und dicht besiedelte Regionen wie das Mittelland oder die Genferseeregion. Hier verdichten sich klimatisch bedingte Einflüsse mit lokal höherer Schadstoffbelastung. Kinder, ältere Menschen sowie Personen mit bestehenden Atemwegserkrankungen wie Asthma gehören zur besonders exponierten Risikogruppe.
In Höhenlagen ist die Pollenbelastung hingegen oft geringer. Dennoch kann der Wind Blütenstaub über weite Distanzen transportieren, sodass auch ländliche und alpennahe Regionen betroffen sein können – wenn auch in geringerem Ausmass.
Umgang mit der Belastung
Die Fachstellen empfehlen eine Kombination aus präventiven Massnahmen und medizinischer Therapie. Dazu gehören unter anderem:
- Pollenschutzgitter an Fenstern
- Vermeidung von Aufenthalten im Freien während der Spitzenbelastung
- Tragen einer Sonnenbrille im Freien
- Abends duschen und Haare waschen, um Pollen zu entfernen
- Innenraumfilter in Lüftungssystemen oder Luftreiniger mit HEPA-Filter
Ergänzend dazu sollten Betroffene regelmässige Pollenprognosen beachten – beispielsweise über den Schweizer Polleninformationsdienst: Dort sind regionale Belastungswerte abrufbar, die bei der Tagesplanung helfen.
Asthmatherapie: Bewährte Medikamente sorgen fürs Durchatmen
Die medikamentöse Langzeitbehandlung von Asthma zielt darauf ab, Entzündungen in den Atemwegen dauerhaft zu kontrollieren, die Lungenfunktion zu stabilisieren und die Häufigkeit sowie Schwere von Asthmaanfällen zu reduzieren. Zum Einsatz kommen dabei sogenannte Controller, also entzündungshemmende Medikamente, die täglich und unabhängig von akuten Symptomen eingenommen werden.
Ein zentraler Bestandteil dieser Therapie sind inhalative Kortikosteroide, wie etwa Beclometason oder Fluticason, die lokal in der Lunge wirken und dabei systemische Nebenwirkungen weitgehend vermeiden. Diese Wirkstoffe werden häufig mit langwirksamen β2-Agonisten kombiniert, um eine doppelte Wirkung zu erzielen: entzündungshemmend und bronchienerweiternd. Ein Beispiel dafür ist Vannair®, das Beclometason und Formoterol verbindet und für die regelmässige Anwendung vorgesehen ist.
Asthmaanfälle bereits im Vorfeld verhindern
Ziel dieser Behandlung ist es, die bronchiale Überempfindlichkeit zu verringern und Asthmaanfälle von vornherein zu verhindern. Die individuelle Dosierung richtet sich nach dem Schweregrad der Erkrankung und wird regelmässig ärztlich überprüft, um Über- oder Unterbehandlungen zu vermeiden. In stabilen Phasen kann eine Dosisreduktion erwogen werden, während bei erhöhter Symptomlast eine Intensivierung erforderlich ist.
Ein Sonderfall in der Langzeittherapie ist die Anwendung von Symbicort®, einem Kombinationspräparat aus Budesonid und Formoterol. Dieses kann nicht nur zur Dauerbehandlung, sondern auch im Rahmen des SMART-Therapieschemas (Single Maintenance And Reliever Therapy) flexibel eingesetzt werden – sowohl präventiv als auch bei Bedarf. Dieses Modell erfordert eine präzise ärztliche Abstimmung, bietet aber eine wirkungsvolle Option für Patienten mit instabiler Krankheitskontrolle.
Notfallmedikamente geben weitere Sicherheit
Das bekannteste und am häufigsten verwendete Notfallmedikament ist Salbutamol Spray bei akuten Asthmaanfällen, das unter Handelsnamen wie Ventolin®, Sultanol® oder Airomir® erhältlich ist. Es gehört zur Gruppe der kurz wirksamen β2-Agonisten (SABA) und wird bei plötzlicher Atemnot eingesetzt.
Auch Formoterol-haltige Sprays wie Oxis® oder Foradil® können zur Notfallbehandlung verwendet werden. Diese zählen zu den langwirksamen β2-Agonisten (LABA), entfalten jedoch ebenfalls eine schnelle Wirkung. Eine Anwendung im Notfall ist allerdings nur dann vorgesehen, wenn das Präparat ausschliesslich Formoterol enthält und die ärztliche Verordnung dies ausdrücklich zulässt.
Die Auswahl der Medikation erfolgt dabei stets nach Rücksprache mit einem Facharzt. Wichtig ist zudem die korrekte Inhalationstechnik, die im Rahmen einer ärztlichen Beratung überprüft werden sollte.
Fazit: Gerade bei Asthma gilt – Vorsorge ist besser als Nachsorge!
Die Zunahme von Pollenallergien und die Verschärfung der Asthmasymptomatik in der Schweiz stehen in engem Zusammenhang mit klimatischen Veränderungen und schwankender Luftqualität. Eine frühzeitige Diagnose, angepasstes Verhalten im Alltag sowie moderne Medikamente können die Lebensqualität betroffener Personen deutlich verbessern. Gleichzeitig bleibt die Herausforderung bestehen, Umweltbelastungen langfristig zu reduzieren, um Atemwegserkrankungen in Zukunft besser vorzubeugen.
(pd, rm)