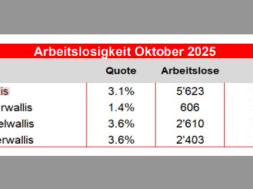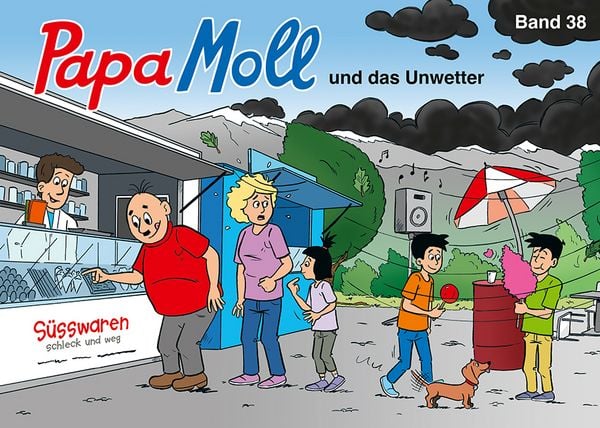Über das Vergängliche und die Vergangenheit Wenn Dinge verschwinden, bleibt manchmal nur, was wir mit ihnen verbunden haben. Doch was, wenn auch diese Verbindung schmerzt?
Von Yannick Ziehli
Der alte Skoda, der von seinem langjährigen Besitzer liebevoll Monique genannt wurde, zollte schliesslich dem Zahn der Zeit Tribut. Er musste sowohl den technischen Anforderungen des Strassenverkehrsamtes als auch seinem schleichenden Verfall ins Auge blicken. Der Skoda wich einem neueren Citroën und markierte so einen sichtbaren Punkt des Wandels. Die Trennung von etwas Vertrautem, das über die Jahre mehr war als nur Fortbewegungsmittel.
Die Vergangenheit – hier in Form eines alten Fahrzeugs – verliert ihren praktischen Bezug, aber nicht zwangsläufig ihre emotionale Präsenz. Doch auch diese kann ins Wanken geraten, je nachdem, wie wir mit den damit verbundenen Empfindungen umgehen. Denn nicht jede Erinnerung trägt Trost. In Blatten/VS dürfte man dem zustimmen. Das Dorf, von einem verheerenden Bergsturz schwer getroffen, ringt nicht nur mit den materiellen Verlusten, sondern mit der Deutung dessen, was geblieben ist. Die NZZ schrieb: «Selbst wenn die Häuser wieder aufgebaut werden, bleiben die Wunden zurück.» In solchen Momenten zeigt sich, dass der Besitz von Dingen weit über Eigentum hinausgeht. Was wir „haben“, geht in unser „Sein“ ein, wie Erich Fromm es sinngemäss formulierte. Die Dinge werden Teil unserer Identität, tragen Bedeutungen, Überzeugungen, Erinnerungsnetze. Eine vererbte Uhr, ein vertrautes Instrument, das Zuhause. Ihre Zerstörung oder ihr Verlust fühlt sich an wie eine Amputation an der Person selbst.
Im Falle des alten Skoda konnte immerhin eine funktionale Nachfolge gefunden werden. Der Verkäufer des neuen Wagens zählte eine lange Liste an Vorteilen gegenüber dem alten Modell auf. Und doch ist es nicht dasselbe. Monique ist nicht ersetzbar. So wie auch ein Dorf nicht einfach ersetzt werden kann.
Matthias Bellwald, der Gemeindepräsident von Blatten, brachte es auf den Punkt: «Wir haben das Dorf verloren, nicht aber das Herz.» Und das „Herz“ ist kein Besitz, sondern ein Symbol für innere Haltung, für Wärme, Gemeinschaftsgeist, Fürsorge, Mut, Zugehörigkeit. Es ist das, was Fromm als Ausdruck des Seins deuten würde. Eine Qualität, die nicht besessen, sondern gelebt wird. Es verweist auf etwas, das nicht durch Zerstörung von aussen genommen werden kann, weil es eine Weise des Daseins ist. Fromm hätte vermutlich gesagt, dass Bellwald eine lebensbejahende Antwort auf den Verlust gibt. Eine, die sich nicht am Materiellen festbeisst, sondern das Eigentliche bewahrt. Nämlich die Fähigkeit zur Verbundenheit und zur Sinnstiftung. Und so markieren manche Verluste nicht nur einen Wandel, sondern auch einen Zugang zu dem, was trägt, wenn das Sichtbare verschwindet.