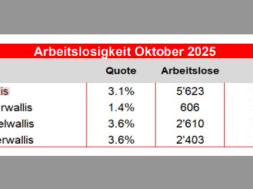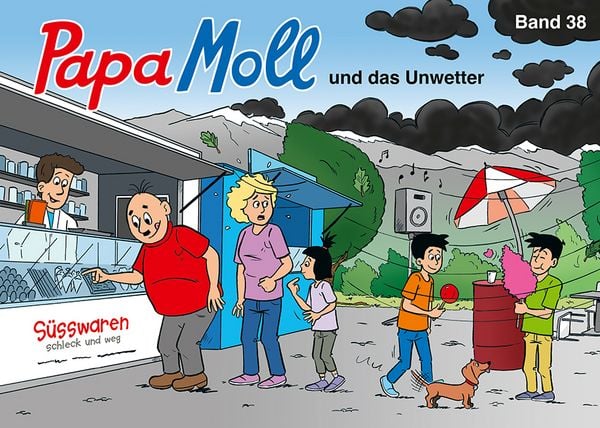Warum das Wallis ein queer-freundlicher Kanton ist
Eine Kolumne von Thomas Baumann
Das einst tiefschwarze, stockkatholische Wallis steht seit einigen Jahren an der Vorfront der queer-freundlichen Kantone. Eine Sensibilisierungskampagne jagt die andere und selbst im Oberwallis wurde die Vorlage für die „Ehe für alle“ deutlicher angenommen als im Rest der (Deutsch-)Schweiz. Dies hat nicht bloss damit zu tun, dass zuständige Departement sein Jahren fest in sozialdemokratischer Hand ist. Auch nicht damit, dass sich sein jetziger Inhaber wohl kaum gegen das Etikett „queer“ wehren würde. (Obwohl man sich fragen kann, was an einem „seltsam“ sein soll, der wie der beste Schwiegersohn aller möglicher Welten wirkt.)
Natürlich: Eine entsprechende Szene gab es auch im Wallis schon immer. Und damit ist nicht die katholische Kirche gemeint, deren Liturgien oftmals noch einiges bombastischer ausfielen als jedes Konzert der Rock-Band „Queen“. Und wo die religiös bedingte Triebunterdrückung leider nur zu oft in missbräuchlichem Verhalten Entladung fand.
Dort, wo die Üsserschwiizer Party feierten, sahen die frommen Walliser schon immer weg, damit der Fluss der Touristenfränkli auch ja nicht gefährdet wird. Wurden in den siebziger Jahren noch busweise Sexarbeiterinnen in die Diskotheken von Leukerbad gekarrt (das NZZ Magazin berichtete vor bald zwei Jahren in einer grossen Reportage darüber), so boten sich die dortigen Thermalbäder zum ‚Cruisen‘ an – was bei einigen älteren Habitues nach wie vor en vogue ist. Ein Thema, zu dem die lokale Tourismusorganisation natürlich beredet schweigt. Aber die Szene ist ja auch diskret.
Der Staat gibt das Geld mit beiden Händen aus
Ganz anders die lautstarke Queer-Szene heute. Der Staatsrat gibt Geld mit beiden Händen aus und die lokale Presse hält selbstverständlich noch zu gerne die offene Hand hin, wenn wieder einmal eine ganze Zeitungsseite mit den zumeist farben- und grafikreichen Weisheiten der entsprechenden Regierungsstellen gefüllt werden soll.
Zwar betont man dort die redaktionelle Unabhängigkeit – aber der Kanton zahlt den vollen Inseratetarif. Offenbar ohne Rabatt. Da dürfte auch im Wallis – gerade im Wallis! – die Devise gelten: Man beisst die Hand nicht, die einem füttert.
Entsprechend findet die heute sehr virulente Szene stets ein offenes Ohr und offene Türen vor, wenn sie nach solchen verlangt. Dass damit eine gewisse, leicht übersteigerte, Empfindsamkeit einhergeht, ist nur zu einfach zu erklären: Wer ständig jeden Wunsch erfüllt kriegt, dessen Frustrationstoleranz ist i.d.R. nicht gerade sehr ausgeprägt. Auch diese Zeitung hat dies schon zu gespüren bekommen – allerdings war die entsprechende Reaktion nicht expressive Aggressivität, sondern eher ein deutlich wahrnehmbares Schmollen.
Gesagt werden muss auch: Die Wortführer dieser Szene sind heutzutage nicht mehr so sehr „normale“ Schwule und Lesben, als Personen, deren Orientierung sich eher im hinteren Bereich des Abkürzungsmonstrums LGBTIG+ bewegt. Die Identitäten sind also um einiges fliessender als auch schon – selbst in der „queeren“ Welt.
Zämustah!
Aber es handelt sich meist um junge Walliserinnen und Walliser. Die Jugend vu hiä eben. Und die Jugend entwickelte schon immer eigene Lebensformen. Natürlich glaubte sie damit auch immer die Welt zu verändern – selbstproklamiert selbstverständlich zum Besseren. In dieser Beziehung unterscheidet sich die aktuelle Jugend-Kohorte in keiner Weise von den vorhergehenden.
Und im Wallis – gerade im oberen Kantonsteil – gilt und galt schon immer die Devise: Zämustah! Da gibt man sich lieber mit verqueren Personen des eigenen Geblüts ab, als mit zugewanderten „Normalos“. Und wenn es dann mal Zugewandete sein sollen, dann tut man sich gleich eine Ukrainerin zu. Wenn schon, denn schon, sagte sich da der WB. Die einzige Zugewanderte, die nicht wie Klaus Stöhlker 30 Jahre benötigte, um ihre Stimme hier bemerkbar machen zu dürfen.
Wahrscheinlich schwingt hier die Hoffnung mit, dass die Attraktion aus dem Ausland bald wieder verschwindet und man sich nicht vertieft damit beschäftigen muss. Denn dass der Walliser Bote zum Beispiel albanischstämmigen Personen oder gar den hier zahlreich vertretenen Portugiesen eine eigene Plattform einräumen könnte: Davon hat man an der Pomona-Strasse noch nie gehört.
Und dies ist die Schattenseite, quasi die schmutzige Schwester der eigenen Queer-Freundlichkeit: Die sprichwörtliche (ober-)walliser Xenophobie. Oder anders gesagt: Lieber ein(e) verqueerte(r) Oberwalliser(in) als ein „normaler“ Zugewanderter.
Immerhin: So ein Zusammengehörigkeitsgefühl, dieses Gefühl, in aller Devianz qua Abstammung einfach dazuzugehören, ist auch eine schöne Sache. Geradezu rührend, wie der Walliser Bote Kontakt zu den verlorenen Söhnen und Töchtern in der Üsserschwiiz hält und ihnen immer wieder eine Plattform bietet. Deren wichtigstes Qualitätsmerkmal doch bloss ist: Walliser Abstammung.
Einmal Walliser, immer Walliser – von diesem Zusammengehörigkeitgefühl könnte sich der Rest der Schweiz auch einmal ein grosses Stück abschneiden. Im Wallis ist eben Blut nach wie vor dicker als Wasser.