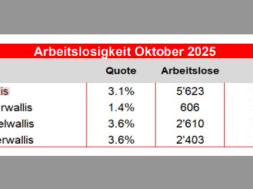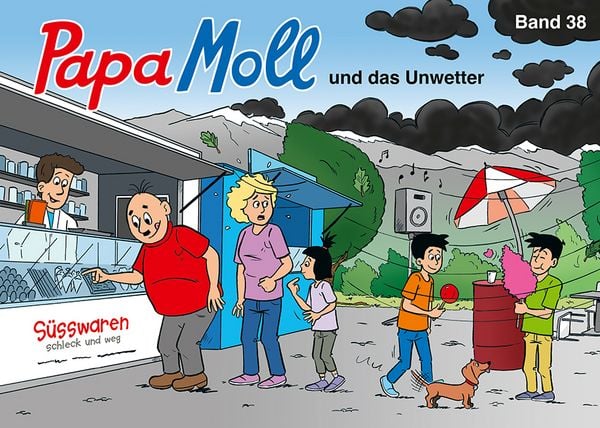Zermatter Abfall-Kabale
Ein Kommentar von Thomas Baumann
Zumindest die Bergdörfer im Wallis sind der Natur abgerungen. Würde der Mensch nicht konstant den Berg verbauen, wäre dort kein menschliches Leben möglich.
Selbst ein mondänes Weltdorf wie Zermatt wird ja im Winter regelmässig von der Umwelt abgeschnitten. Ohne die unermüdliche Leistung der Mitarbeiter der Unterhaltsdienste, die mit oft knochenharter Arbeit in luftiger Höhe das Dorf vor den drohenden Naturgefahren bewahren, gäbe es dort keinen Tourismus.
Dies ist vielleicht die grösste Leistung überhaupt in den Walliser Seitentälern.
Diese Abgeschiedenheit hat sicherlich einer gewissen Mentalität Vorschub geleistet: Wer so exponiert lebt, kann nur in Solidarität überleben. Denn im Notfall kann einem nur der helfen, der selbst vor Ort ist.
Dieser Drang zur Selbsthilfe führte gar soweit, dass ein Dorf seine eigene Rettungsfluggesellschaft hat. Jedenfalls trägt diese zumindest noch den Namen des Dorfs in ihrem Namen.
Solidarität oder Vetternwirtschaft?
Auch die Politik vergass nicht, an diese Instinkte zu appellieren: Mit dem Slogan „Zämustah“ pflasterten die C-Parteien im letzten Staatsratswahlkampf das ganze Oberwallis – und erinnerten dabei irgendwie an eine Rinder- oder Schafherde im Regen. Entsprechend geduscht wurden die C-Parteien dann auch im Wahlkampf.
Wo aber endet notwendiges „Zämustah“ und wo beginnt ganz gewöhnliche Vetternwirtschaft? Dies ist nicht immer einfach zu sagen, wenn man sich nicht einfach auf einen anonymen Markt versorgen kann, sondern notfalls selbst anpacken muss.
Wenn der lokale Bauunternehmer dank Aufträgen der Gemeinde seine schweren Fahrzeuge besser auslasten kann – dann ist das Strukturerhaltung. Aber wenn man diese notfalls kurzfristig für die Schneeräumung oder andere Räumungsmassnahmen einsetzen kann, dann ist das eben auch ein Plus für die Gemeinde.
Die Frage, die sich bei solchen Geschäften immer stellt, ist also: Wo endet Solidarität und wo beginnt Vetternwirtschaft?
Der andere Faktor, der die Wagenburg- oder Selbstversorgermentalität in diesen Dörfern massgeblich mitbestimmte, war die jahrhundertelange Armut. Wer arm ist, der weiss: Was man hat, das hat man. Da muss man ihm nicht mit komplizierten ökonomischen Theorien kommt, die ungefähr das besagen: Was du heute ausgibst, kommt übermorgen als Nachfrage zu dir zurück. Nein, was man hat, das hat man. Die Reserven, die man hat, gibt man nicht leichtfertig aus.
Also sagte man sich in Zermatt: Es ist ja schön und gut, wenn irgend so ein Berner Abfallentsorger ein innovatives Konzept mit dem schönen Namen Alpenluft bei uns umsetzt. Aber noch schöner wäre es natürlich, wenn die rund zwei Millionen im Jahr darüber hinaus vollständig im Dorf bleiben würden. (selbst bei einem teurerem Anbieter mit weniger Kompetenz)
Diese Denke übersieht jedoch eins: Wenn alle so denken würden, dann würden wir wohl noch alle zusammen irgendwo in einer Höhle sitzen.
Merkantilistische Rezepte
Der Merkantilismus ist eine Wirtschaftspolitik, die Leistungsbilanzüberschüsse anstrebt, indem möglichst viel exportiert und möglichst wenig importiert wird. Ziel ist es, dadurch möglichst grosse finanzielle Reserven anzuhäufen. Es ist offensichtlich, dass eine solche Politik nicht funktionieren kann, wenn sie alle Länder der Welt betreiben würden: Denn wenn kein Land importieren will, dann kann auch kein Land exportieren.
Wie die graue Theorie eben besagt: Die Nachfrage des einen ist immer die Einnahme des anderen – und wenn ich heute einen Franken ausgebe, dann kommt dieser tatsächlich früher oder später zu mir zurück. Oder vielleicht ist sie im Umkehrschluss noch besser verständlich: Wenn nie irgendjemand einen Franken ausgeben würde, dann würde auch nie jemand einen Franken einnehmen.
Der Wohlstand der Welt basiert eben gerade darauf, dass man die Dinge anderswo nachfragt, die anderswo günstiger oder in besserer Qualität produziert werden können.
Auf das Beispiel Zermatt angewandt: Es ist unbestritten, dass kaum ein anderen Dorf auf dieser Welt ein besseres Bergpanorama zu „produzieren“ vermag als Zermatt. Hingegen haben sich Zermatter Firmen in Sachen Abfallentsorgung bisher nicht besonders hervorgetan.
Dennoch findet die Gemeinde Zermatt: Bei der Abfallentsorgung gibt es ab sofort Heimatschutz!
Zum Glück für Zermatt ticken nicht alle Gemeinden so wie der Ort am Fuss des Matterhorns. Denn würden alle Gemeinden dieser Welt ihren Einwohnerinnen und Einwohnern vorschreiben, jeweils nur den dorfeigenen Hügel zu besteigen anstatt dies an einem anderen Ort zu tun – dann gäbe es in Zermatt überhaupt keine Touristen.
Was aber in Zermatt die Tourismusbranche ist, ist in einer anderen Gemeinde vielleicht die Entsorgungsbranche: Nämlich von essentieller Bedeutung für die lokale Gemeinde. Genauso wie Zermatt vor schweren Zeiten stünde, wenn aus merkantilistischen Gründen niemand mehr das touristische Angebot Zermatt nachfragen würde – ebenso stehen jene andere Gemeinde vor harten Zeiten, wenn niemand mehr die Entsorgungskompetenzen der dort ansässigen Firmen nachfragt.
Dies sollten die Zermatter und andere Oberwalliser Merkantilisten vielleicht auch einmal bedenken, bevor sie zu Hause fleissig Heimatschutz betreiben für Branchen, für die anderswo bessere Kompetenzen verfügbar wären.